Von den Waffen im Kinderzimmer · 21. Dezember 2017
Vor einigen Tagen erhielt ich die frohe Botschaft, eine Stiftung werde mit einem finanziellen Beitrag meine Idee fördern, mit dem Bleisatz und Buchdruck schlecht lesenden und schreibenden Grundschülern einer benachbarten Grundschule einen freudvollen Zugang zur Schrift zu ermöglichen. Schon Anfang des Jahres sollen vier Kinder den Versuch mit mir beginnen. Einen Lehrplan wird es nicht geben, da jedes Kind andere Hürden zu überwinden hat und ich diese noch nicht kenne. (Die Überlegungen dazu finden Sie in diesem PDF.) Ich lasse mich darauf ein, die Möglichkeiten zu durchdenken, damit ich die richtigen Offerten finde, wenn die Kinder in der Werkstatt stehen. Dabei fiel mir eine alte Geschichte ein, die sich vor acht Jahren zutrug.
Anno 2009 hatte einer meiner Schüler den Wunsch geäußert, eine Maschinenpistole zu bauen. Ich habe das damals hier im Druckerey-Blog nur kurz erwähnt, nicht aber die Hintergründe dazu. Ich wollte sie schon immer mal notieren.
Der Knabe damals, also vor acht Jahren, hatte seinen ersten Tag in unserer Arbeitsgemeinschaft, für die ich einmal pro Woche sechs Kinder aus einer Grundschule in meine Werkstatt holte. Das Kind war mir von professioneller Seite überlassen worden mit dem knappen Hinweis, es sei »schwierig«.
Nun habe ich zwar selbst einmal in das Mysterium der Erziehungskunde ein wenig hineinstudiert, mit Diplom und staatlicher Anerkennung gar, vor allem aber Romane gelesen, in denen Figuren wie Betsey Trotwood vorkommen (Sie kennen vielleicht »David Copperfield« von Charles Dickens?). Oder der Graf von Monte Christo (Dumas). Um nur zwei Klassiker zu erwähnen, in denen sich eine ältere Dame und ein Krieger in den besten Jahren um etwas bemühen, das »schwierige« Kinder gern öfter fänden: Gerechtigkeit und Verständnis. Ich finde Hinweise und Warnungen wie »schwieriges Kind« wenig nützlich und habe aus solchen Romanen gelernt, daß der Mensch zuerst das naheliegende tun sollte, bevor er sich um die Etiketten der Pädagogie kümmert.
Wenn Kinder mit dem Stigma »schwierig« weitergereicht werden, hat das doch Folgen? Selbst wenn man sich fest vornimmt, jede Begegnung vorurteilsfrei zu beginnen, so setzt ein solcher Hinweis Schranken ins Unterbewußte, die man sich erst bewußt machen muß, um sie mühsam wieder hochzuziehen. Und wieviel mag man sogar unbewußt am Stigma mitwirken, weil man sich nicht unmittelbar gegen alle Vorurteile gänzlich wehren kann?
Als ich das Kind dann sah, dazu das blöde Etikett »schwierig« vor dem inneren Auge, öffnete sich mir gewissermaßen ein Begleitbüchlein zum Pädagogenhinweis: schüchtern, schweigsam, ein ganz klein wenig pummelig, etwas steif und ungelenk, Trotz im Blick – das ist einfach kein Wunschbild für bestimmte Erzieher. Auf dem Weg in die Werkstatt kamen wir noch nicht ins Gespräch. In der Werkstatt dann wurde wie immer als erstes verabredet, was jeder machen möchte. – Ich hatte eine Art Wunderkind in der Gruppe, das beharrlich ein Buch mit eigenen Gedichten füllte. Andere langweilten sich erst eine Viertelstunde und hatten dann Ideen, oft sehr gute. (Langeweile wird heute leider nicht mehr geschätzt – als Startphase, als Bedingung, sich selbst zu bewegen. Die Köpfe sind voll mit vorgekauten Gedanken.) Wieder andere Kinder brachten einen Plan mit oder sprudelten sowieso vor Einfällen. Es gab auch Tage, da brachte einer mal gar nichts selbst zustande, sondern schaute nur zu, vielleicht aus Ermattung. Ich fand das vernünftig. Wir hatten keinen Produktionsplan. Und man lernt auch beim Zuschauen. Nach einigen Wochen brauchte ich nur noch ungefähre technische Anleitungen zu geben, die Kinder kamen gut für einige Zeit allein zurecht.
Das »schwierige« Kind, das zum ersten Mal bei mir war, eröffnete mir nun zum Beginn, es wolle eine Maschinenpistole bauen.
So etwas ist für einen pädagogischen Skeptiker wie mich eine Steilvorlage. Der Knabe konnte nicht wissen, daß ich bereits Erfahrungen als Sozialarbeiter im Jugend- und im Männergefängnis gemacht hatte. Daß ich die langen sozialen Karrieren auf schiefen Bahnen ein wenig kannte, die man damals machen konnte. Ich hatte vor allem gelernt, wie meine Klienten meine Sprache sprechen lernten, weil Sozialarbeiter die Sprache ihrer Klienten oft nicht verstehen. (Verehrte Leser, Sie müßten einmal hören, wie clevere delinquente Jugendliche mit phantasielosen Sozialarbeitern reden und deren Fachsprache beherrschen und mit Empathie ermitteln, was man von ihnen hören will! Bilderbuchdialoge!)
Dieser Knabe wußte längst, wie man Pädagogiker auf den Topf setzt. So weit hatten sie ihn gebracht. Wenn ein Kind auf diese Weise zu provozieren meint, erprobt es den Erwachsenen, und zwar auf dessen eigener Bühne. Die anderen Kinder sehen sehr gut, was da vor sich geht. Sie alle haben auch gewisse Erwartungen und beziehen selbst eine Position. Das sogenannte schwierige Kind rechnet nun gewohnheitsmäßig mit einer Eskalation. Es erwartet, daß sein Vorschlag abgelehnt wird, und es wäre nicht verblüfft, wenn man sich darüber lustig macht oder es streng rügt und ihm das erklärt, was es ja schon weiß, also diesenfalls, daß man sich ja in einer Druckerei befinde und nicht in einer Waffenfabrik. Wobei das schon eine humorvolle Variante wäre.
Die Provokation war eine doppelte. Erstens eine Verweigerung des vorgegebenen Themas, zweitens ein Tabubruch. Viele Pädagogen reagieren allergisch, wenn sie mit Kriegsspielzeug in Berührung kommen. Nicht nur sie. Energische Pazifisten gibt es überall. Ich habe einmal als Gast in einer Familie erlebt, wie eine Mutter und ihr etwa fünfjähriges Kind in Hysterie ausbrachen, weil das Kind, dem alle Waffen verboten waren, mit einem Matchbox-Auto »schoß«, also es wie eine Pistole hielt und mit dem Mund Schußgeräusche imitierte. Worauf die Mutter auf ihren Sohn stürzte und ihm mit starker Hand das Auto entwand, was ihn in Tränen und Gebrüll ausbrechen ließ, nun ihn seine Mutter auf ihren Schoß zerrte und ihm im Klammergriff einen pazifistischen Vortrag hielt, in dem sie das Kind gewissermaßen für den Weltfrieden zuständig erklärte. Die Dame war keine Pädagogin, aber sie war ideologisch so stark beeinträchtigt, daß sie das Wohl ihres Kindes aus den Augen verloren hatte, und so auch ihr eigenes.
Kinder sammeln ihre Erfahrungen mit solchen Tabus. Sie dürfen zum Beispiel Spielwaffen nicht mit in den Kindergarten nehmen, weil es sich um »Kriegsspielzeug« handelt. So paradox kurzsichtig ist pädagogische Logik. Ich bin in einem Staat aufgewachsen, der seine Kinder militärisch geschult hat. Plastikpanzer und Soldatenfiguren in jedem Kindergarten. Soldatenkinderlieder, die mir heute noch in Erinnerung sind. Militärische Formationsbildung auf dem Schulhof ab der ersten Klasse in Form sogenannter Fahnenappelle, Kinder in Uniformen oder uniformen Accessoires (erst Halstücher der Pioniere, später Hemden der Jugendorganisation), vormilitärische Ausbildung für Jungen ab der neunten Klasse – und als Lehrling, mit sechzehn, in Kampfuniform. Und dieses Volk, mit seiner Armee, mit kasernierter Polizei und berüchtigtem Geheimdienst, hat nicht einmal bei seinem Staatsstreich einen Schuß abgegeben. So funktioniert Erziehung nämlich nicht, auch wenn Ideologen das von der Pädagogik immer erwarten und verlangen, ganz gleich in welche Richtung.
Nun also das Kind in meiner Werkstatt mit dem Wunsch nach einem in der zivilisierten Welt geächteten Gerät: Ich möchte eine Maschinenpistole bauen. So ein Kind strahlt dabei nicht. Es weiß, wenn es momentan nicht »funktioniert«. Sein Körper spricht mit. Es läßt den Kopf hängen, guckt schief, sitzt krumm, wirkt verloren. Und es ist dann ganz herzwärmend, wenn man den Wunsch ernstnimmt, keine Witze macht, keine Miene zieht, sondern einen Plan zur Umsetzung dieses Wunsches überlegt und sieht, wie das Kind sich langsam aufrichtet. Wellpappe, Stift, Cutter, komm, wir bauen das Ding. Das verblüffte Kind denkt anfangs, man werde jeden Moment abbrechen und wieder in den Weltenlauf einrasten, und es rechnet lange damit und wird sich erst ganz besinnen können, wenn der Tag vorbei ist, ohne daß die Erwartungen erfüllt wurden.
 Der Junge kam zu seiner Waffe, und ich für ihn zu einem Ruf als umgänglicher Typ. Leider war das gegen Ende des Schuljahres und war er nur kurz auf der Schule und kam nur ein paarmal und setzte und druckte dann auch. Vielleicht eher mir zu Gefallen, als daß er in der kurzen Zeit Freude daran fand, genau habe ich das nicht erkennen können.
Der Junge kam zu seiner Waffe, und ich für ihn zu einem Ruf als umgänglicher Typ. Leider war das gegen Ende des Schuljahres und war er nur kurz auf der Schule und kam nur ein paarmal und setzte und druckte dann auch. Vielleicht eher mir zu Gefallen, als daß er in der kurzen Zeit Freude daran fand, genau habe ich das nicht erkennen können.
Spielzeugwaffen faszinieren, wenn ein Kind einen Sinn dafür entwickelt hat. Sie dienen auf den ersten Blick zur Abkürzung von Auseinandersetzungen und verleihen dem Benutzer Macht. Aber nur, wenn man sich auf die Folgen geeinigt hat. »Du kannst jetzt nicht wieder aufstehen, du bist tot!« – »So’n Blödsinn, das war ’n Streifschuß, du bist selber tot.« Man muß übereinkommen, wenn man damit spielen will. Auf den zweiten Blick braucht man also für dieses Spiel mehr Kommunikationsgeschick als für andere, etwa Spiele aus dem Karton mit den gedruckten Regeln auf der Verpackung oder Ballspiele, wo Verläufe nicht so grundsätzlich diskutiert werden müssen.
In den Rollenspielen, die man als Kind durchlebt, waren mir Matchbox und Pistolen die liebsten Geräte. Wahrscheinlich, weil Spiele damit die stärksten Verwandlungen erlauben, sowohl als Autofahrer (dort sind Polizisten und Feuerwehrleute beliebt, also Leute, die mit Autorität rettend eingreifen und Ordnung schaffen) als auch als Waffenträger (in diesem Rollenspiel ist ebenfalls die Polizistenrolle gefragt, vielleicht weil das Gesetz am Ende immer siegt – Kinder sind konservativ). Umberto Eco (ebenfalls kein Pädagoge) faßt es in seinem »Brief an meinen dreijährigen Sohn« so zusammen: »Stefano, mein Sohn, ich werde dir Gewehre schenken. Denn ein Gewehr ist kein Spiel. Es ist ein Anstoß zu einem Spiel. Mit ihm mußt du eine Situation erfinden, ein Beziehungsgeflecht, eine Dialektik von Ereignissen. Du machst Peng mit dem Mund und entdeckst, daß dein Spiel soviel taugt, wie du selber hineinlegst und nicht schon vorfabriziert darin findest. Du stellst dir vor, daß du Feinde vernichtest und befriedigst damit einen Urtrieb, den keine Zivilisation dir je austreiben wird (außer sie macht dich zum Neurotiker, reif für betriebliche Eignungstests à la Rorschach). Aber bald geht dir auf, daß dein Feindevernichten eine Spielkonvention ist, ein Spiel unter anderen Spielen, und so lernst du es als ein wirklichkeitsfernes Treiben erkennen, dessen Grenzen dir beim Spielen durchaus bewußt sind. Du reagierst deine Wut und deine Komplexe ab und wirst frei für andere Botschaften, die weder Tod noch Zerstörung betreffen, ja es wird wichtig sein, daß dir Tod und Zerstörung für immer als Phantasiegebilde erscheinen, wie Rotkäppchens böser Wolf, den wir alle als Kinder gehaßt haben, ohne deshalb einen irrationalen Haß auf Wolfshunde zu entwickeln.«
Ich bin gespannt, wie »schwierig« die Kleinen sind, die mit dem Lesen und Schreiben nicht so zurande kommen, wie man sich das wünscht. Und auf welche Umwege ich geführt werde, um dann am Setzkasten und beim Alphabet zu landen, diesem phantastischen Code aus 26 Zeichen, der es uns erlaubt, Ideen aufzuschreiben und Geschichten zu erzählen.
PS: Schöne Weihnachten!
— Martin Z. Schröder
Raketen im Maschinensaal · 10. November 2017
 Wenn nach einem ordentlichen herbstlichen Drucktag, an dem gewissermaßen die Fetzen flogen, die Maschinen einen Job nach dem andern druckten, in der Setzerei Besprechungen mit Besuchern stattfanden, Lieferanten Sendungen abgenommen wurden, der Nachbarskater gekrault wurde – wenn also nach zehn Stunden Arbeit die beiden Patenkinder, drei- und fünfjährig, vorbeischauen und ihren Onkel ein, zwei Bücher vorlesen lassen, dabei Struzen Chips aus Südtirol knabbernd und Hollersarft mit Eiswürfeln schlürfend, dann möchten sie danach gern noch ein wenig spielen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten in der Werkstatt. Es ist ja soviel da. Raketen werden gebaut, Raketenbeförderungsanhänger mit der Ösmaschine zusammengefügt, und dann finden Reisen zum Mond statt. Bis die Eltern zum Abendessen rufen, der Kater heimgeschickt wird und der Onkel sich trollt.
Wenn nach einem ordentlichen herbstlichen Drucktag, an dem gewissermaßen die Fetzen flogen, die Maschinen einen Job nach dem andern druckten, in der Setzerei Besprechungen mit Besuchern stattfanden, Lieferanten Sendungen abgenommen wurden, der Nachbarskater gekrault wurde – wenn also nach zehn Stunden Arbeit die beiden Patenkinder, drei- und fünfjährig, vorbeischauen und ihren Onkel ein, zwei Bücher vorlesen lassen, dabei Struzen Chips aus Südtirol knabbernd und Hollersarft mit Eiswürfeln schlürfend, dann möchten sie danach gern noch ein wenig spielen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten in der Werkstatt. Es ist ja soviel da. Raketen werden gebaut, Raketenbeförderungsanhänger mit der Ösmaschine zusammengefügt, und dann finden Reisen zum Mond statt. Bis die Eltern zum Abendessen rufen, der Kater heimgeschickt wird und der Onkel sich trollt.
 Das Aufräumen überläßt man noch meistens dem Alten, und wenn der so einen Platz am Fuße seiner Heidelberger Tiegel sieht, dann ist er gerührt und räumt auch gern wieder auf.
Das Aufräumen überläßt man noch meistens dem Alten, und wenn der so einen Platz am Fuße seiner Heidelberger Tiegel sieht, dann ist er gerührt und räumt auch gern wieder auf.
— Martin Z. Schröder
Ein aufmerksamer Besucher · 5. Dezember 2016
Der vierjährige Patenbub war zu Besuch. Ich hatte aber keine Zeit zum Spielen, ich mußte drucken. Dann bleibe er ein wenig und schaue zu, sagte der Knabe. Und er stellte sich auf zwei wacklige Farbdosen und reckte seine Nase über die Schließplatte.
»Druckst du grün?« – »Nein, heute drucke ich rot.« – »Wann druckst du wieder grün?« – »Weiß ich nicht, ich hab gerade nichts grünes zu drucken, morgen drucke ich blau.« – »Druck doch mal wieder grün.« – »Es gibt sehr viele Farben. Schau mal, das ist ein Farbfächer, aus dem man die Farben aussucht, die gedruckt werden sollen.« Das Kind sieht sich den HKS-Fächer an und sieht Goldreste auf dem Tisch. »Und Gold?« – »Gold-Pigmente habe ich hier.« Ich nehme den Topf mit dem Goldklumpen aus dem Regal. »Das ist ein Klumpen Pigmente. Wenn man Gold drucken will, nimmt man etwas davon und ein wenig Firnis und rührt die Farbe an.« – »Dann wird es flüssig.« Dem stimme ich zu und hänge die während des Gesprächs zusammengefügte Druckform in die Maschine.
Nun stelle ich fest, daß ich keinen sauberen Spachtel mehr habe. Ich türme die bunten Spachtel vor mir auf und greife nach dem Benzin. »Vorsicht, jetzt stinkt’s.« Das Kind schnuppert am Benzin. »Es wäre mir lieb, wenn du deine Nase von diesem Platz etwas entfernst, denn gesund ist das Zeug nicht.« – »Dann sehe ich aber nichts.« – »Warte!« Ich hole eine Leiter und stelle sie mitten in den Maschinenraum. Der Bub nimmt oben Platz und strahlt herab. Jeden Handgriff soll ich jetzt erklären. Ich verwende keine spezielle Sprache für das Kind, ich halte davon nichts. Das interessiert fragende Kind wird aufgeklärt über Form- und Walzenwaschmittel, Feuergefahr und Gift (»Ach deshalb hast du einen Feurlöscher!«). Ich gebe rote Farbe ins Farbwerk des Heidelbergers. »Warum verteilt sich die Farbe?« Ich lasse die Maschine langsam laufen und erkläre: »Siehst du diesen großen glänzenden Zylinder? Der macht eine Seitwärtsbewegung, rechts, links, rechts, links, immer hin und her. Und die kleinen Gummiwalzen hier drehen sich gegenläufig auf dem Zylinder. Dabei wird die Farbe zerquetscht und breit verteilt.« Er nickt. Nach dem ersten Druck wird die Form auf die Mitte des Formats gestellt. Ich messe mit Typometer und Fadenzähler und rechne laut und zügig in Cicero und Punkt des Duodezimalsystems. Der Bub meint: »Bei dir lerne ich rechnen.« – »Du kannst wahrscheinlich schon rechnen.« – »Nein.« Wir stellen fest, daß er durchaus weiß, was eins und eins ergibt, und vertiefen müssen wir das jetzt nicht. »Ich kann alles bei dir lernen.« Das Kind beherrscht, wie man sieht, die Klaviatur des Kompliments. Dann wird die Auflage gedruckt.
Beim späteren Spiel mit Matchbox meint der Junge, daß ich sehr viel besitze. Sehr viel gute Dinge, um etwas damit zu machen. An Spielzeug ist das Kind nicht arm, aber in einer Werkstatt werden die Dinge verwandelt. Aus einem Stück Wellpappe wird eine Brücke. Aus einem Holzklotz eine Absperrung. Papierschnipsel bekommen ein Loch mit der Ahle und werden Bauteile für den Kran. Klebt man zwei Kartonstücken zusammen und falzt die Ränder nach oben, bekommt man einen langen Anhänger für den Kran. Es könnte sein, daß hier alles nur ein Rohmaterial ist. Das ist eine wichtige Lehre: die Dinge anschauen und ihnen ansehen, was man aus ihnen machen kann.
Gesellschaftliche Fragen: Was vergeben wir uns, wenn wir die Arbeit und die vermeintlich Unbeteiligten so voneinander abgrenzen, wie wir es tun. Jede Werkstatt, ob darin nun Krawatten gereinigt werden oder Schuhe besohlt und geputzt oder Schlüssel geschliffen oder Brot gebacken oder Suppe gekocht oder eine Socke gestopft oder ein Bild gemalt oder ein Schemel repariert, ist eine Offizin, ein Ort, an dem etwas gemacht wird. Selbst ein Supermarkt als Ort des Handels ist an sich eine interessante Stätte. Früher waren die Wohnstuben und Küchen Werkstätten, auch die Höfe und Keller. Mit Fertignahrung und Wegwerfkleidung hat das Heim einen bedeutenden Teil seiner Funktion als Offizin verloren. Dafür gibt es Bildschirme, auf denen kann man sich lustige Filme anschauen, in denen Werkstätten oder Fabriken vorkommen.
Es ist durchaus romantisch, wenn ein Kind auf einer Leiter sitzt und das Werkstatt-Treiben anschaut und kommentiert und erfragt. Man denkt sich als Erwachsener vielleicht: der Druckerei-Onkel mit seinen Krawatten und Fliegen, die blaue Schürze, die Lesebrille – ein Meister Eder! Während ich in der Tat glücklich über jede dieser Minuten durch meine Bilderbuchwerkstatt stapfe, denke ich mir: Familien können das zu Hause haben, beim Kochen sogar jeden Tag. Man muß nur selbst etwas tun wollen, möglichst auch Freude daran haben, erst dann wird es für Kinder interessant. Kinder kommen und gehen, tun ein wenig mit und lassen es wieder liegen und können beim übernächsten Mal etwas, das uns verblüfft. Sie sind sich nach meiner Erfahrung darin alle ähnlich. – Ich kenne zwei Neunjährige, die können einen Kuchen backen. Ohne Backmischung oder Fertigteig. Ihre Mutter ist eine grandiose Köchin. – Es liegt wohl von Anfang an in uns, daß wir mittun wollen, daß wir verstehen wollen, wie sich Dinge bilden und wie man Dinge erschafft. Und es liegt leider auch an uns, wenn wir das dem Nachwuchs vorenthalten mit der unsäglich irrigen Begründung, daß wir ihn so besser darauf vorbereiten können, erwachsen zu sein, also wohl nichts mehr selbst machen zu können. Mit langen Aufenthalten in Kinder-Einrichtungen. Mit fertigem Spielzeug in Kinderzimmern. In einer pädagogischen Situation lassen sich solche Momente aber nicht erschaffen: ein Kind auf einer Leiter in einem Maschinenraum, in dem jemand seinem Beruf nachgeht und sich zusehen läßt und das Kind Rechnen lernen will.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [3]
Kinder in der Druckerei – Mit Bleisatz gegen LRS · 6. Oktober 2016
Das Kürzel LRS bezeichnet dreierlei: Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, -störung oder -schwäche. Dieses Phänomen soll vorliegen, wenn die Leistungen eines Kindes im Lesen und Schreiben oder einem von beiden deutlich unter dem Niveau der Altersnorm, der Schulklassennorm oder der gemessenen Intelligenz und daran geknüpfter Erwartungen liegen. Die Fachleute sind sich über die genaue Definition nicht einig; hier und da wird auch über genetische Bedingungen von Legasthenie oder physische und psychische Voraussetzungen für diese Probleme gesprochen. Einig sind sich die Fachleute aber über den Tatbestand der Normabweichung. LRS ist also, einfach ausgedrückt, wenn jemand schlechter lesen und schreiben kann, als seine Umwelt es von ihm erwartet.
Wenn dem Kind mit schlechten Lese- und Rechtschreibfertigkeiten in der Schulkarriere Entwicklungswege versperrt werden, wenn die Eltern unzufrieden sind und das Kind darunter leidet, wenn es von Mitschülern oder Freunden oder Verwandten für seine minderen Leistungen beim Lesen und Schreiben verhöhnt und ausgelacht wird, dann sollte überlegt werden, dem Kind zu helfen, seine Lesefähigkeit und sein Schreibenkönnen zu verbessern, ganz gleich, wie man die Probleme mit der Schriftsprache nennt.
Ob die Abweichung von der Norm rechtfertigt, die nach dieser Vorstellung mangelhafte Leistung des Kindes als Schwierigkeit, Störung, Schwäche oder gar Krankheit einzuordnen, sei dahingestellt. Ich halte es nicht für sinnvoll, diese Kategorien zu bemühen, weil die Entwicklungsunterschiede von Kindern deutlich über die starren Vorstellungen von Klassenstufen hinausreichen. Von bis zur vier Jahren Entwicklungsunterschied sprechen Fachleute bei Grundschülern, und der Entwicklungsprozeß verläuft freilich nicht auf allen zu entwickelnden Feldern gleichmäßig.
Mit der Druckerei und der Bleisatztechnik von Gutenberg möchte ich einen neuen Zugang zur Schriftsprache anbieten, und ich bin überzeugt davon, diesen Zugang jedem Kind eröffnen zu können.
Das Konzept wird in diesem PDF ausgeführt.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [2]
Attraktive Unordnung · 29. Mai 2015
 Gelegentlich bringen Besucher ihre Kinder in meine Werkstatt mit. Die ganz kleinen liegen in warmen Tüchern und äußern keine Meinung. Manche der älteren finden die Werkstatt wenig interessant und wollen rasch wieder fort. Und manchmal gibt es Kinder, denen steht nach wenigen Augenblicken ins Gesicht geschrieben, wie enorm interessant sie dieses Ambiente finden.
Gelegentlich bringen Besucher ihre Kinder in meine Werkstatt mit. Die ganz kleinen liegen in warmen Tüchern und äußern keine Meinung. Manche der älteren finden die Werkstatt wenig interessant und wollen rasch wieder fort. Und manchmal gibt es Kinder, denen steht nach wenigen Augenblicken ins Gesicht geschrieben, wie enorm interessant sie dieses Ambiente finden.
 Was genau finden sie eigentlich so interessant? Es sind auch die kleinen Buchstaben, aber dabei handelt es sich um eine schwierig aussehende Materie. Winzige Buchstaben haufenweise in Kästen, na schön. Das ist durchaus auch mal ganz interessant, reißt einen aber nicht vom Hocker.
Was genau finden sie eigentlich so interessant? Es sind auch die kleinen Buchstaben, aber dabei handelt es sich um eine schwierig aussehende Materie. Winzige Buchstaben haufenweise in Kästen, na schön. Das ist durchaus auch mal ganz interessant, reißt einen aber nicht vom Hocker.
 Alle Dienstleistungsgespräche laufen aus Sicht des Dienstleisters mit einer gewissen Routine ab. Ob das Ärzte, Schlosser oder Drucker sind. Überraschende Fragen haben sie kaum zu gewärtigen. Diese Gesprächsroutine gibt dem Dienstleister ausreichend Möglichkeiten zur Parallelbeobachtung. Er kann auch noch an etwas anderes denken, wenn er über etwas spricht, das er auswendig kennt, über das er schon unzählige Male gesprochen hat.
Alle Dienstleistungsgespräche laufen aus Sicht des Dienstleisters mit einer gewissen Routine ab. Ob das Ärzte, Schlosser oder Drucker sind. Überraschende Fragen haben sie kaum zu gewärtigen. Diese Gesprächsroutine gibt dem Dienstleister ausreichend Möglichkeiten zur Parallelbeobachtung. Er kann auch noch an etwas anderes denken, wenn er über etwas spricht, das er auswendig kennt, über das er schon unzählige Male gesprochen hat.
 Während der Drucker also über Papier, Schrift, Prägung, Farbe berichtet, hat er Gelegenheit, seine Besucher zu beobachten. Das ist für Beratungsgespräche auch wichtig, weil Kommunikation nicht nur über Sprache stattfindet, sondern auch über Mimik und Gestik, weil der Berater auch aus dem Gesamtbild seines Gesprächspartners Informationen filtert, die in die Beratung einfließen.
Während der Drucker also über Papier, Schrift, Prägung, Farbe berichtet, hat er Gelegenheit, seine Besucher zu beobachten. Das ist für Beratungsgespräche auch wichtig, weil Kommunikation nicht nur über Sprache stattfindet, sondern auch über Mimik und Gestik, weil der Berater auch aus dem Gesamtbild seines Gesprächspartners Informationen filtert, die in die Beratung einfließen.
 Aber auch das ist schon eine Routine, die nicht die komplette Aufmerksamkeit des Beraters bindet. Man kann auch nebenher noch den stillen Besuchern zuschauen und ihren Blicken folgen. Und manche Kinder schauen die Werkstatt auf eine Weise an, daß ich mir einbilde, auch ihren Gedankengängen ein wenig folgen zu können. Mir ist aufgefallen, daß ihr Interesse Schauplätzen gilt, die für mich Nebenbilder abgeben. Sie begutachten Orte, die ich gar nicht mehr wahrnehme.
Aber auch das ist schon eine Routine, die nicht die komplette Aufmerksamkeit des Beraters bindet. Man kann auch nebenher noch den stillen Besuchern zuschauen und ihren Blicken folgen. Und manche Kinder schauen die Werkstatt auf eine Weise an, daß ich mir einbilde, auch ihren Gedankengängen ein wenig folgen zu können. Mir ist aufgefallen, daß ihr Interesse Schauplätzen gilt, die für mich Nebenbilder abgeben. Sie begutachten Orte, die ich gar nicht mehr wahrnehme.
 Das sind die unübersichtlichen Plätze. Materialhaufen. Werkzeugansammlungen. Die größte Attraktivität ist die Unordnung. Sie verspricht Forschungsgebiete und Unterhaltung. So etwas gibt es in ordentlichen Haushalten nicht. Und offenbar sagt hier niemand diesem Drucker, daß er seine Zimmer mal aufräumen soll. Das sieht nach einem durchaus angenehmen Dasein aus.
Das sind die unübersichtlichen Plätze. Materialhaufen. Werkzeugansammlungen. Die größte Attraktivität ist die Unordnung. Sie verspricht Forschungsgebiete und Unterhaltung. So etwas gibt es in ordentlichen Haushalten nicht. Und offenbar sagt hier niemand diesem Drucker, daß er seine Zimmer mal aufräumen soll. Das sieht nach einem durchaus angenehmen Dasein aus.
 In den nebenstehenden Fotos habe ich aufgezeichnet, wo die Blicke dieser Kinder hängenbleiben. Manchmal gehen sie vorsichtig herum und schauen, manchmal bleiben sie auf einem Stuhl sitzen und lassen die Bilder auf sich wirken.
In den nebenstehenden Fotos habe ich aufgezeichnet, wo die Blicke dieser Kinder hängenbleiben. Manchmal gehen sie vorsichtig herum und schauen, manchmal bleiben sie auf einem Stuhl sitzen und lassen die Bilder auf sich wirken.
 Solche Plätze gibt es heute nur noch wenige. Früher bot das Arbeitsleben der Erwachsenen viel mehr Unterhaltung. Es gab viel mehr Werkstätten und sogar Fabriken mitten in der Stadt. Noch vor 40 Jahren, als ich Kind war, wurde die Kneipe vis-à-vis unserer Wohnung von Pferdefuhrwerken mit Bierfässern beliefert, die von lederbeschürzten kräftigen Herren auf einer kleinen Rampe vom Wagen in eine Kellerluke gerollt wurden, während die Pferde einen Hafersack vor die Mäuler gehängt bekamen und ihre Äppel fallen ließen.
Solche Plätze gibt es heute nur noch wenige. Früher bot das Arbeitsleben der Erwachsenen viel mehr Unterhaltung. Es gab viel mehr Werkstätten und sogar Fabriken mitten in der Stadt. Noch vor 40 Jahren, als ich Kind war, wurde die Kneipe vis-à-vis unserer Wohnung von Pferdefuhrwerken mit Bierfässern beliefert, die von lederbeschürzten kräftigen Herren auf einer kleinen Rampe vom Wagen in eine Kellerluke gerollt wurden, während die Pferde einen Hafersack vor die Mäuler gehängt bekamen und ihre Äppel fallen ließen.
 Der Gemüsehändler neben der Kneipe hatte einen dreirädrigen Lieferwagen, auf dem er Kartoffeln und Kohl und was es sonst so gab damals, transportierte. Auf sogenannten »Ameisen«, Miniatur-LKW, wurden Briketts ausgefahren und von Männern in Schürzen und schwarzgefleckten Gesichtern in die Häuser getragen. Koks wurde einfach auf die Straße gekippt und von Heizern mit riesigen Gabeln in Kellerluken oder auf Schubkarren befördert.
Der Gemüsehändler neben der Kneipe hatte einen dreirädrigen Lieferwagen, auf dem er Kartoffeln und Kohl und was es sonst so gab damals, transportierte. Auf sogenannten »Ameisen«, Miniatur-LKW, wurden Briketts ausgefahren und von Männern in Schürzen und schwarzgefleckten Gesichtern in die Häuser getragen. Koks wurde einfach auf die Straße gekippt und von Heizern mit riesigen Gabeln in Kellerluken oder auf Schubkarren befördert.
 Im Keller zündete man Kerzen an, schummeriges Licht gab es nur in den feuchten Gängen. Matt grünlich schimmerte der fluoreszierende Leuchtanstrich aus Kriegszeiten, als die Keller auch Luftschutzräume waren. Jugendliche schraubten auf der Straße an Mopeds, Kinder spielten auf Höfen und Straßen. Sonnabends wurden von Männern auf der Straße Autos gewaschen. Polizisten regelten den Verkehr. Schornsteinfeger waren so schwarz und sahen mit ihren Kugelbesen und Leitern exakt so aus wie in den Kinderbüchern.
Im Keller zündete man Kerzen an, schummeriges Licht gab es nur in den feuchten Gängen. Matt grünlich schimmerte der fluoreszierende Leuchtanstrich aus Kriegszeiten, als die Keller auch Luftschutzräume waren. Jugendliche schraubten auf der Straße an Mopeds, Kinder spielten auf Höfen und Straßen. Sonnabends wurden von Männern auf der Straße Autos gewaschen. Polizisten regelten den Verkehr. Schornsteinfeger waren so schwarz und sahen mit ihren Kugelbesen und Leitern exakt so aus wie in den Kinderbüchern.
 Wenn Straßenbahnen über Weichen fuhren, mußte der Fahrer aussteigen und sie mit einem riesigen Hebel umlegen. Die einzige Tätigkeit, bei der man Erwachsenen heute auf der Straße zuschauen kann, ist das Starren und Tippen auf ihren Taschentelefonen. Wenn man mal einen Geldtransporter und einen Mann mit einer großen Kassette dazu sieht, ist das schon ein Ereignis.
Wenn Straßenbahnen über Weichen fuhren, mußte der Fahrer aussteigen und sie mit einem riesigen Hebel umlegen. Die einzige Tätigkeit, bei der man Erwachsenen heute auf der Straße zuschauen kann, ist das Starren und Tippen auf ihren Taschentelefonen. Wenn man mal einen Geldtransporter und einen Mann mit einer großen Kassette dazu sieht, ist das schon ein Ereignis.
 Wenn ich diese Bilder aus meiner Werkstatt so anschaue, dann finde ich, daß sich meine Mutter ihre Versuche, mich zu einem ordentlichen Menschen zu erziehen, etwas sparsamer hätte unternehmen können. Mein Ordnungssystem hat sich nie geändert. Ich finde, was ich brauche. Die Arbeit wird heute genauso ordentlich gemacht, wie ich früher meine Spielzeugstädte auf dem Teppich errichtete. Mein System funktioniert.
Wenn ich diese Bilder aus meiner Werkstatt so anschaue, dann finde ich, daß sich meine Mutter ihre Versuche, mich zu einem ordentlichen Menschen zu erziehen, etwas sparsamer hätte unternehmen können. Mein Ordnungssystem hat sich nie geändert. Ich finde, was ich brauche. Die Arbeit wird heute genauso ordentlich gemacht, wie ich früher meine Spielzeugstädte auf dem Teppich errichtete. Mein System funktioniert.
 Und das Wunderbare ist: Wenn ich mich in meiner Werkstatt umschaue und versuche, sie mit den Augen des Kindes zu sehen, das ich einmal war, so ist es mein ganz wunderbarer Spielplatz mit seiner eigenen Ordnung. Die Versalien werden so eifrig und mit Sorgfalt ausgeglichen wie früher die Spielzeugautos auf dem Teppich säuberlich parkten. Wo es nötig ist, herrscht gar penible Ordnung. Die Setzkästen sind in Schuß und wohlsortiert, die Stehsatzmenge hält sich in Grenzen, die Regale mit Blindmaterial könnten nicht ordentlicher sein, die Maschinen sind geölt, die Druckfarben übersichtlich gestapelt. Dazwischen gibt es die fotografierten Haufen. Schlachtfelder nennt man sie in Kinderzimmern. Natürlich müssen diese Haufen immer mal wieder aufgeräumt werden, aber nur, wenn es für die Arbeit nötig ist, nicht allwöchentlich aus Prinzip.
Und das Wunderbare ist: Wenn ich mich in meiner Werkstatt umschaue und versuche, sie mit den Augen des Kindes zu sehen, das ich einmal war, so ist es mein ganz wunderbarer Spielplatz mit seiner eigenen Ordnung. Die Versalien werden so eifrig und mit Sorgfalt ausgeglichen wie früher die Spielzeugautos auf dem Teppich säuberlich parkten. Wo es nötig ist, herrscht gar penible Ordnung. Die Setzkästen sind in Schuß und wohlsortiert, die Stehsatzmenge hält sich in Grenzen, die Regale mit Blindmaterial könnten nicht ordentlicher sein, die Maschinen sind geölt, die Druckfarben übersichtlich gestapelt. Dazwischen gibt es die fotografierten Haufen. Schlachtfelder nennt man sie in Kinderzimmern. Natürlich müssen diese Haufen immer mal wieder aufgeräumt werden, aber nur, wenn es für die Arbeit nötig ist, nicht allwöchentlich aus Prinzip.
Diese Überlegungen führen mich weiter. Was habe ich mir damals, vielleicht als Acht- oder Zehnjähriger, eigentlich vorgestellt, wie ich als Erwachsener einmal sein würde? Ich hatte Ideen, Kinderideen. Ich sah meinen Vater, einen leitenden Journalisten, und mir gefiel seine Arbeit. Mir gefiel auch, was die Grafiker in seiner Redaktion taten oder die Kollegen in dem Verlag, wo meine Mutter arbeitete. Aber das Erwachsensein war etwas unvorstellbar Fernes. Ein fremdes Leben. Ich meinte, ich würde nicht mehr ich selbst sein. Ich würde mich nicht nur äußerlich in einen ganz anderen Menschen verwandeln, der Dinge tut, die Erwachsene tun. Ich würde auch erwachsen denken. Ich würde vernünftig werden, was immer das war, das wüßte ich dann. Ich würde gewiß auch sehr ordentlich werden, wie sich die Erwachsenen das vorstellten. Wie diese Metamorphose vor sich gehen sollte, konnte ich mir nicht denken. Es kamen auch immer noch Laufbahnen als erfolgreicher Detektiv oder als berühmter Schriftsteller in Frage. Vor allem dachte ich, würde das Leben sehr leicht werden, weil man sich alles aussuchen kann, wenn man erwachsen ist. Man muß nicht morgens in die Schule gehen, die man nicht mag, sondern geht einer ausgesuchten Beschäftigung nach, für die man sehr viel Geld bekommt. Also viel mehr als das wöchentliche Taschengeld. Und man kann Schokolade essen, wann und in welchen Mengen man es für richtig hält. Und abends so lange lesen und fernsehen, wie man möchte.
Auch daran schließt sich eine Frage an: Bin ich ein Erwachsener geworden, mit dem ich als Kind zufrieden gewesen wäre? Einerseits: Nein. Die kindlichen Forderungen an das Erwachsensein sind kaum erfüllbar. Es hat keine wunderbare Verzauberung gegeben, sondern ein manchmal zähes, auch schwieriges, manchmal auch lustiges und flottes Erwachsenwerden. Der Vorsprung besteht nur in Erfahrung, und keine einzige wird einem hübsch verpackt geschenkt. Man wird kein ganz anderer, man schleppt sich immer mit herum. Andererseits: Ja. Auch wenn ich kein Detektiv geworden bin, es nicht einmal versucht habe, so sehe ich heute an den eingangs geschilderten Kinderbeobachtungen, daß ich ein bedeutendes Vermögen um mich angehäuft habe. Es gibt in meiner Werkstatt, meinem täglichen Lebensraum, diese attraktiven interessanten Haufen. Den Papiersack neben der Schneidemaschine mit den weichen Schnipseln, die zerbeulte Benzinkanne, die durcheinanderliegenden Werkzeuge, diese Räume, in denen Berge von Dingen liegen, mit denen ich etwas machen kann. Schade, daß ich mir nicht durch die Jahrzehnte rückwärts auf den Rücken klopfen kann und sagen: Knirps, mach dir keine Sorgen, du wirst in vierzig Jahren immer noch so hübsch spielen, nur sind es dann keine kleinen Autos mehr auf dem Teppich, sondern Buchstaben und große Maschinen, und dazu kannst du nach Belieben Schokolade essen, bis dir übel davon wird. Eine sehr erfolgreiche Karriere. Ich kann nur heutigen Knirpsen, falls sie danach fragen sollten, einige Hoffnung machen: Solange du einen Willen hast, folge halbwegs unbeirrt deinen Interessen, dann stehen die Aussichten günstig, daß es recht hübsch wird als Erwachsener. Trotz Krampfadern, Rheuma, Gicht, Haarausfall, Schlaflosigkeit, Impotenz, Hämorrhoiden und was man als Erwachsener sonst an Schicksal zu tragen hat. Dafür mit Schokolade in rauhen Mengen – oder sauren Gurken, ganz nach Belieben.
— Martin Z. Schröder
Kinder machen Bücher (und ich auch eines) · 1. Mai 2015
 Im April hatte ich sechs Zehnjährige aus einer benachbarten Grundschule zu Gast. Diese Schule veranstaltet einmal jährlich eine Woche ein Fest schöpferischer Arbeit. Da wird gefilzt, getanzt, gemalt, geschnitzt, und dieses Jahr wurde auch geschrieben, gesetzt, gedruckt, gebunden. Am Ende des vierten Tages saßen wir vor den fertigen Druckbogen.
Im April hatte ich sechs Zehnjährige aus einer benachbarten Grundschule zu Gast. Diese Schule veranstaltet einmal jährlich eine Woche ein Fest schöpferischer Arbeit. Da wird gefilzt, getanzt, gemalt, geschnitzt, und dieses Jahr wurde auch geschrieben, gesetzt, gedruckt, gebunden. Am Ende des vierten Tages saßen wir vor den fertigen Druckbogen.
 Bis dahin hatten meine Gäste sich Texte ausgedacht, sie Buchstabe für Buchstabe aus dem Setzkasten gesetzt, Abzüge gemacht, Korrektur gelesen. Linolschnitte wurden angefertigt, Papier zugeschnitten, Umschläge gerillt, Texte und Linolschnitte gedruckt. Zwischendurch waren wir auch mal auf dem Spielplatz, und während der Arbeit gab es genug Pausen, um die Schaukel im Garten neben der Druckerei vor dem Einrosten zu bewahren.
Bis dahin hatten meine Gäste sich Texte ausgedacht, sie Buchstabe für Buchstabe aus dem Setzkasten gesetzt, Abzüge gemacht, Korrektur gelesen. Linolschnitte wurden angefertigt, Papier zugeschnitten, Umschläge gerillt, Texte und Linolschnitte gedruckt. Zwischendurch waren wir auch mal auf dem Spielplatz, und während der Arbeit gab es genug Pausen, um die Schaukel im Garten neben der Druckerei vor dem Einrosten zu bewahren.
 Die Titelfindung war nicht ganz leicht, denn das Buch enthält Texte über einen netten Wolf in der Wildnis, einen Tassenkuchen (Cupcake), einen jungen Feuerwehrmann, Basketball und Yu-Gi-Oh, ein mir bislang unbekanntes Kartenspiel.
Die Titelfindung war nicht ganz leicht, denn das Buch enthält Texte über einen netten Wolf in der Wildnis, einen Tassenkuchen (Cupcake), einen jungen Feuerwehrmann, Basketball und Yu-Gi-Oh, ein mir bislang unbekanntes Kartenspiel.
 An den ersten beiden Tagen war es für mich fast zu anstrengend. Ich hatte eine ganze Weile nicht mit Kindern gearbeitet und war überrascht von der Kraft der Spontaneität, die Zehnjährigen innewohnt und die mit dem Perfektionsdrang eines Druckers nicht ganz leicht unter einen Hut zu bringen ist. Aber am dritten Arbeitstag hatte ich mich schon daran gewöhnt, zumal die Kinder einen starken Willen zur guten Stimmung ausstrahlen, dem ich mich nicht entziehen konnte. Es hat dann nach der Eingewöhnung auch mir richtig Spaß gemacht, und ein paar Druckfehler habe ich eben übersehen. Auch meine Gäste zeigten sich am Ende höchst zufrieden und bedauerten, daß es nach fünf Tagen vorbei war.
An den ersten beiden Tagen war es für mich fast zu anstrengend. Ich hatte eine ganze Weile nicht mit Kindern gearbeitet und war überrascht von der Kraft der Spontaneität, die Zehnjährigen innewohnt und die mit dem Perfektionsdrang eines Druckers nicht ganz leicht unter einen Hut zu bringen ist. Aber am dritten Arbeitstag hatte ich mich schon daran gewöhnt, zumal die Kinder einen starken Willen zur guten Stimmung ausstrahlen, dem ich mich nicht entziehen konnte. Es hat dann nach der Eingewöhnung auch mir richtig Spaß gemacht, und ein paar Druckfehler habe ich eben übersehen. Auch meine Gäste zeigten sich am Ende höchst zufrieden und bedauerten, daß es nach fünf Tagen vorbei war.
 Dieses Bild zeigt den Grund dafür, warum die Blogeinträge in den letzten Monaten spärlich geworden sind. An diesem Buch arbeite ich schon seit bald fünf Jahren immer mal wieder, aber nachdem ich den Verlag gebeten habe, mich unter Termindruck zu setzen, ist es nun geschrieben und wird zur Zeit überarbeitet. Manche Fragen erwiesen sich als harte Nuß. Woran, beispielsweise, erkennt ein Typograf, ob eine Druckschrift gut ist. Was bedeutet Schönheit in Bezug auf Schrift? In jedem Beruf gibt es Kenntnisse, die in Lehrbüchern nur gestreift werden, die sich durch Erfahrung mitteilen. »Implizites Wissen« nennen das Soziologen. Von diesem Detailwissen, diesen kleinen Berufsgeheimnissen habe ich einige genauer untersucht. Meine Handgriffe protokolliert und danach für dieses Buch allgemeinverständlich erklärt. Das war viel Arbeit, und damit waren die Abende und Wochenenden des letzten Jahres ausgefüllt. Jetzt wird also lektoriert und verbessert, und im Herbst soll dann ein schönes Buch fertig sein. HIER kann man einen Blick auf die erste Ankündigung des Verlages werfen.
Dieses Bild zeigt den Grund dafür, warum die Blogeinträge in den letzten Monaten spärlich geworden sind. An diesem Buch arbeite ich schon seit bald fünf Jahren immer mal wieder, aber nachdem ich den Verlag gebeten habe, mich unter Termindruck zu setzen, ist es nun geschrieben und wird zur Zeit überarbeitet. Manche Fragen erwiesen sich als harte Nuß. Woran, beispielsweise, erkennt ein Typograf, ob eine Druckschrift gut ist. Was bedeutet Schönheit in Bezug auf Schrift? In jedem Beruf gibt es Kenntnisse, die in Lehrbüchern nur gestreift werden, die sich durch Erfahrung mitteilen. »Implizites Wissen« nennen das Soziologen. Von diesem Detailwissen, diesen kleinen Berufsgeheimnissen habe ich einige genauer untersucht. Meine Handgriffe protokolliert und danach für dieses Buch allgemeinverständlich erklärt. Das war viel Arbeit, und damit waren die Abende und Wochenenden des letzten Jahres ausgefüllt. Jetzt wird also lektoriert und verbessert, und im Herbst soll dann ein schönes Buch fertig sein. HIER kann man einen Blick auf die erste Ankündigung des Verlages werfen.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [2]
Vermögensbildung · 31. Oktober 2012
 Der Chefbankier hat die Bank nach sich selbst benannt, deshalb heißt sie K-Bank. Wechselgeld hat der Neunjährige nicht drucken wollen, sondern sich an einem hübschen Bündel erfreut, das er auf dem Handtiegel gedruckt hat.
Der Chefbankier hat die Bank nach sich selbst benannt, deshalb heißt sie K-Bank. Wechselgeld hat der Neunjährige nicht drucken wollen, sondern sich an einem hübschen Bündel erfreut, das er auf dem Handtiegel gedruckt hat.
 Ob K. jemanden findet, der die vom Bleisatz gedruckten Scheine akzeptiert? Es muß ja nicht in voller Höhe sein.
Ob K. jemanden findet, der die vom Bleisatz gedruckten Scheine akzeptiert? Es muß ja nicht in voller Höhe sein.
 Auf diesem Foto sind die Rand-Ornamente zu sehen.
Auf diesem Foto sind die Rand-Ornamente zu sehen.
 Das Wort EURO wurde aus der Bigband gesetzt.
Das Wort EURO wurde aus der Bigband gesetzt.
 Und Hausschrift der K-Bank ist die Kavalier.
Und Hausschrift der K-Bank ist die Kavalier.
 Hier ist die ganze Druckform zu sehen (die Ziffern sind aus schmalhalbfetter Futura gesetzt). In zwei Stunden wurden etwa fünfzigtausend Euro produziert. (Natürlich wird das Bargeld nicht in der Werkstatt gelagert.)
Hier ist die ganze Druckform zu sehen (die Ziffern sind aus schmalhalbfetter Futura gesetzt). In zwei Stunden wurden etwa fünfzigtausend Euro produziert. (Natürlich wird das Bargeld nicht in der Werkstatt gelagert.)
— Martin Z. Schröder
Kommentare [4]
Boy And Green · 9. Februar 2011
Neulich hatte ich einen jungen Menschen (elfjährig) aus dem Freundeskreis zu Besuch, der zwar seinem Vater eine Freude bereitete, indem wir gemeinsam einen Brief an diesen aus der Garamond setzten und druckten, aber solche privaten Nachrichten kann ich schlecht im Blog veröffentlichen.
 Nun war der jüngere Bruder in der Werkstatt, neunjährig, und dieser ging auf meinen Vorschlag, einen Geheimdienstausweis herzustellen, mit Enthusiasmus ein. Am Ende des Tages stand seine berufliche Perspektive fest: Profikiller. Ich hoffe, nicht eines Tages dafür verantwortlich gemacht zu werden. Man kann an dem Namen des Geheimdienstes und der zusätzlichen Lizenz erkennen, wo die Verantwortung liegt.
Nun war der jüngere Bruder in der Werkstatt, neunjährig, und dieser ging auf meinen Vorschlag, einen Geheimdienstausweis herzustellen, mit Enthusiasmus ein. Am Ende des Tages stand seine berufliche Perspektive fest: Profikiller. Ich hoffe, nicht eines Tages dafür verantwortlich gemacht zu werden. Man kann an dem Namen des Geheimdienstes und der zusätzlichen Lizenz erkennen, wo die Verantwortung liegt.
 Ich habe allerdings erst an den Fotoapparat gedacht, als Youli, mein halbgriechischer Besucher, meine Gummihandschuhe und die Farbskulptur entdeckt hatte.
Ich habe allerdings erst an den Fotoapparat gedacht, als Youli, mein halbgriechischer Besucher, meine Gummihandschuhe und die Farbskulptur entdeckt hatte.
 Welche dann durch Farbreste, die schon viel zu lange herumstanden, eine weitere Schicht aufs Dach bekam.
Welche dann durch Farbreste, die schon viel zu lange herumstanden, eine weitere Schicht aufs Dach bekam.
 Ich hatte dieses Werk schon mal gezeigt vor ein paar Jahren. Es ist meine Alterssicherung. Wenn ich in vielen Jahren (Klopf auf Holz) die Werkstatt verlasse, wird diese dann sehr hohe Skulptur an ein großes Auktionshaus geliefert und als Gegenwartskunst mit Geschichte zu einem Rekordpreis für einen Farbhaufen versteigert werden.
Ich hatte dieses Werk schon mal gezeigt vor ein paar Jahren. Es ist meine Alterssicherung. Wenn ich in vielen Jahren (Klopf auf Holz) die Werkstatt verlasse, wird diese dann sehr hohe Skulptur an ein großes Auktionshaus geliefert und als Gegenwartskunst mit Geschichte zu einem Rekordpreis für einen Farbhaufen versteigert werden.
 Youli hat mitgeholfen, vielleicht gebe ich ihm später was ab vom Gewinn. Wenn er einst als Profikiller hinter schwedischen Gardinen schmoren wird, kann ich ihm ja ein paar Vitamintabletten zukommen lassen.
Youli hat mitgeholfen, vielleicht gebe ich ihm später was ab vom Gewinn. Wenn er einst als Profikiller hinter schwedischen Gardinen schmoren wird, kann ich ihm ja ein paar Vitamintabletten zukommen lassen.
 Gedruckt haben wir aber auch, nämlich den oben erwähnten Ausweis. Leider habe ich den Bleisatz nicht fotografiert. Das Auge in der Mitte hatte Youli nämlich in meiner Dingbats-Sammlung in einem Kasten entdeckt.
Gedruckt haben wir aber auch, nämlich den oben erwähnten Ausweis. Leider habe ich den Bleisatz nicht fotografiert. Das Auge in der Mitte hatte Youli nämlich in meiner Dingbats-Sammlung in einem Kasten entdeckt.
 Ich war der Meinung, das Auge sieht nicht gefährlich genug aus. Und habe dann auch noch den geschmolzenen Käse auf der 1909 erstmals gegossenen Bleischrift Schneekönigin der Gießerei Heinrich Hoffmeister in Leipzig ausgemalt. Die Titelschrift ist die Lichte Futura, und die Lizenz unten links wurde von Youli aus der Futura dreiviertelfett gesetzt.
Ich war der Meinung, das Auge sieht nicht gefährlich genug aus. Und habe dann auch noch den geschmolzenen Käse auf der 1909 erstmals gegossenen Bleischrift Schneekönigin der Gießerei Heinrich Hoffmeister in Leipzig ausgemalt. Die Titelschrift ist die Lichte Futura, und die Lizenz unten links wurde von Youli aus der Futura dreiviertelfett gesetzt.
 Je länger der Tag voranschritt, desto besser kamen wir auf schlimme Ideen. Dieser Ausweis soll ja so aussehen, daß derjenige, der ihn ins Gesicht gehalten bekommt, nachdrücklich schockiert wird. Geheimdienstausweise, die wie Reisepässe aussehen, sind doch lächerlich. Das Auge wurde also noch blutunterlaufener, und die Schrift wurde mit grünem Schleim ausgestattet (woher der Gedanke kam, sieht man sicherlich an den ersten Fotos dieses Eintrages), auf welchen wir noch rote leuchtende Pickel setzten.
Je länger der Tag voranschritt, desto besser kamen wir auf schlimme Ideen. Dieser Ausweis soll ja so aussehen, daß derjenige, der ihn ins Gesicht gehalten bekommt, nachdrücklich schockiert wird. Geheimdienstausweise, die wie Reisepässe aussehen, sind doch lächerlich. Das Auge wurde also noch blutunterlaufener, und die Schrift wurde mit grünem Schleim ausgestattet (woher der Gedanke kam, sieht man sicherlich an den ersten Fotos dieses Eintrages), auf welchen wir noch rote leuchtende Pickel setzten.
 Zum Schluß entdeckte Youli als weitere berufliche Perspektive noch das Dasein als Drucker und übte schon mal einen seriösen Gesichtsausdruck bei der Arbeit am Pedaltiegel. Ich meine, das kann was werden. Ob die Perspektiven lohnender sind als die des Profikillers, kann ich allerdings nicht beurteilen, unter meinen Kunden hat sich noch keiner enttarnt.
Zum Schluß entdeckte Youli als weitere berufliche Perspektive noch das Dasein als Drucker und übte schon mal einen seriösen Gesichtsausdruck bei der Arbeit am Pedaltiegel. Ich meine, das kann was werden. Ob die Perspektiven lohnender sind als die des Profikillers, kann ich allerdings nicht beurteilen, unter meinen Kunden hat sich noch keiner enttarnt.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [3]
Ein Buch! Ein Buch! · 17. Juli 2009
Die Ferien haben schon begonnen, ich komme erst jetzt dazu, einen  Bericht über Dales fertige Arbeit nachzureichen. Es war dann am Ende doch so viel an seinem Büchlein zu tun, daß er am Wochenende außerhalb des Schul-Kurses in die Werkstatt kam. Die Druckbogen hatten wir schon gefalzt, jetzt trug Dale sie zusammen und steckte sie ineinander, dann rillte er den gedruckten Umschlag und steckte die Druckbogen ein.
Bericht über Dales fertige Arbeit nachzureichen. Es war dann am Ende doch so viel an seinem Büchlein zu tun, daß er am Wochenende außerhalb des Schul-Kurses in die Werkstatt kam. Die Druckbogen hatten wir schon gefalzt, jetzt trug Dale sie zusammen und steckte sie ineinander, dann rillte er den gedruckten Umschlag und steckte die Druckbogen ein.
 Und dann ging es ans Binden. 49 Exemplare, das ist viel Arbeit, zumal für jemanden, der vor nicht langer Zeit zehn Jahre alt geworden ist. Ich habe erst mit der Ahle Löcher vorgestochen, dann haben wir gemeinsam die Bücher gebunden. Drei Löcher, der Faden geht in der Mitte von außen nach innen, dann aus einem der äußeren Löcher nach außen, durch das dritte Loch wieder nach innen und in der Mitte erneut nach außen.
Und dann ging es ans Binden. 49 Exemplare, das ist viel Arbeit, zumal für jemanden, der vor nicht langer Zeit zehn Jahre alt geworden ist. Ich habe erst mit der Ahle Löcher vorgestochen, dann haben wir gemeinsam die Bücher gebunden. Drei Löcher, der Faden geht in der Mitte von außen nach innen, dann aus einem der äußeren Löcher nach außen, durch das dritte Loch wieder nach innen und in der Mitte erneut nach außen.
 Und zwischen den beiden außen aus dem mittleren Loch guckenden Fäden wird der am Rücken durchlaufende Faden verknotet. Die Enden werden abgeschnitten.
Und zwischen den beiden außen aus dem mittleren Loch guckenden Fäden wird der am Rücken durchlaufende Faden verknotet. Die Enden werden abgeschnitten.
 Zum Schluß wird das Buch in der Schneidemaschine an den drei offenen Seiten beschnitten.
Zum Schluß wird das Buch in der Schneidemaschine an den drei offenen Seiten beschnitten.
 Und dann hält man die Frucht einer Arbeit in der Hand, die sich über ein halbes Jahr hinzog. Der junge Dichter, Setzer, Drucker und Buchbinder in Personalunion hatte nun aber auch die Grenzen seiner Geduld erreicht. Wir sind beide sehr zufrieden mit dem Werk, und stolz auch.
Und dann hält man die Frucht einer Arbeit in der Hand, die sich über ein halbes Jahr hinzog. Der junge Dichter, Setzer, Drucker und Buchbinder in Personalunion hatte nun aber auch die Grenzen seiner Geduld erreicht. Wir sind beide sehr zufrieden mit dem Werk, und stolz auch.
 Der Nachname ist auf diesem Bild geschwärzt, weil ich den Datenschutz gerade so junger Menschen wichtiger finde als das Foto der Buchseite. Man muß nicht schon so jung von Suchmaschinen erfaßt werden.
Der Nachname ist auf diesem Bild geschwärzt, weil ich den Datenschutz gerade so junger Menschen wichtiger finde als das Foto der Buchseite. Man muß nicht schon so jung von Suchmaschinen erfaßt werden.
 Jetzt zeigt sich, daß die Planung aufgeht und der Linolschnitt “Schneeflocke” neben das Wintergedicht gelangt.
Jetzt zeigt sich, daß die Planung aufgeht und der Linolschnitt “Schneeflocke” neben das Wintergedicht gelangt.
 Die meisten sind Naturgedichte, dazwischen finden sich aber auch ein dadaistischer Vers und diese Alliteration. Oder ist es ein Tautogramm? Oder ein Stabreim? Oder all das zugleich?
Die meisten sind Naturgedichte, dazwischen finden sich aber auch ein dadaistischer Vers und diese Alliteration. Oder ist es ein Tautogramm? Oder ein Stabreim? Oder all das zugleich?
 Der etwas erschöpfte Schöpfer macht sich mit dem Gefühl vertraut, einen Stapel eigener Bücher in der Hand zu halten. 15 Exemplare gelangen in den Verkauf. Das Werk ist für 8 Euro in der Werkstatt zu haben, nur dort, nicht per Versand.
Der etwas erschöpfte Schöpfer macht sich mit dem Gefühl vertraut, einen Stapel eigener Bücher in der Hand zu halten. 15 Exemplare gelangen in den Verkauf. Das Werk ist für 8 Euro in der Werkstatt zu haben, nur dort, nicht per Versand.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [1]
Produktdesign · 12. Juli 2009
Neulich war es sehr heiß, als ich meine Schüler von ihrer Schule abholte, und meinem Vorschlag, ihnen als erste Unterrichtsmaßnahme des Nachmittages ein Eis zu spendieren, wurde mit Wohlwollen entgegengetreten. In der Werkstatt dann war es zwar etwas kühler, aber ich hielt es für angebracht, zur Schonung unserer Nerven keinerlei Arbeitserwartung auszusprechen. G. wollte das erste Kapitel hören aus dem wunderbaren Buch von Franz Fühmann “Die Hälse der Pferde im Turm von Babel”, also las ich vor. Nachdem man sich bei dem Sprachspielkapitel um Wörter mit nur einem Vokal etwas erholt hatte, fing F. an eine Mappe für ihr bereits gedrucktes Briefpapier zu konstruieren, die wir binnen zwei Stunden sogar fertig hatten. Mit eingeklebter Lasche für die Briefbogen, gedrucktem Titel und rotem Band zum Schließen, das Mädchen hat Talent. G. freute es zu hören, daß seine DÜL-Karten Anklang gefunden haben. Und J. entwickelte erstaunlichen Einfallsreichtum im Produktdesign.
Keineswegs möchte ich hier eine Debatte über Kriegsspielzeug lostreten und merke nur dies an: Wer andern verbieten will, solches zu verwenden oder selbst zu bauen, unterrichtet in erster Linie nicht den Pazifismus, sondern, durch das Verbot, die Diktatur. Ich spreche in der Werkstatt auch Verbote und Gebote aus: man darf hier nicht rennen, beispielsweise, und man muß sich, wenn man Blei angefaßt hat, vor dem Keksverzehr die Hände waschen. Anweisungen, die mit Gefahrenabwehr begründet werden und für jeden einsichtig sind, also keine ideologischen oder Meinungsdiktate.
Als diese Maschinenpistole skizziert und gebaut wurde, aus Wellpappe und mit einem Cutter,  hätte ein Moralpädagoge vielleicht gute Gründe für Einsprüche. Aber Moral ist in deutlich gezogenen allgemeingültigen Grenzen vor allem: Privatsache. Kinder sind vollwertige Menschen, und es steht mir nicht zu, die moralischen Grenzen für sie nach eigenem Ermessen enger zu ziehen als allgemein üblich. Einst hab ich wie fast alle Buben sehr viel mit Plastikpistolen, Holzgewehren und Gummimessern hantiert — und mir ist echte körperliche Aggression heute so recht zuwider.
hätte ein Moralpädagoge vielleicht gute Gründe für Einsprüche. Aber Moral ist in deutlich gezogenen allgemeingültigen Grenzen vor allem: Privatsache. Kinder sind vollwertige Menschen, und es steht mir nicht zu, die moralischen Grenzen für sie nach eigenem Ermessen enger zu ziehen als allgemein üblich. Einst hab ich wie fast alle Buben sehr viel mit Plastikpistolen, Holzgewehren und Gummimessern hantiert — und mir ist echte körperliche Aggression heute so recht zuwider.
Ich war also moralisch unbeeindruckt, zumal Kinder in diesem Alter Wirklichkeit und Wirklichkeitskonstruktion (also Spiel) unterscheiden können, und dafür aber sehr angetan von der Geschicklichkeit, mit der hier gezeichnet und geschnitten wurde. Und als das Gewehr aus Wellpappe sich als zu flexibel erwies, griff sich mein humorvoller und geschickter Gast die Schablone und erfand derart ein Ding, das zugleich Waffe und Schild mit Sehschlitz ist. Was mich sehr amüsierte. Ausstellungen über Produktdesign an Hochschulen zeigen auch nichts anderes als solche Dummies.
— Martin Z. Schröder
DÜL gestartet · 1. Juli 2009
 Neulich habe ich von DÜL berichtet. Der Unternehmensgründung von Gustav aus der Schülergruppe. In mehreren Druckgängen sind die Papiere der Firma nun fertiggestellt worden.
Neulich habe ich von DÜL berichtet. Der Unternehmensgründung von Gustav aus der Schülergruppe. In mehreren Druckgängen sind die Papiere der Firma nun fertiggestellt worden.
Gustav hatte die Idee, Fahrkarten zu drucken. Ich meinte, das Transportunternehmen, das diese Billetts ausgebe, sollte einen Namen haben.
“Dül”, schlug Gustav vor.
“Was soll das heißen?” fragte ich.
“Dül. Dül heißt Dül, ganz einfach, ist doch klar, was soll es sonst heißen, Dül eben”, erwiderte Gustav.
Ich wandte ein, daß dies als Wortschöpfung keinen Inhalt habe bzw. einen beliebigen. Ob es nicht eine Abkürzung sein könnte, und wenn, wofür?
Gustav mußte nicht lange grübeln. “Deutsche Übersichtslenkung”, schlug er vor.
 Und ich spürte sofort, daß wir alle genau diese brauchen. Eine Übersichtslenkung bringt uns dorthin, wohin wir wollen. Eine Deutsche Übersichtslenkung wäre gar in der Lage, die Regierung überflüssig zu machen. Es ist vielleicht nicht ganz demokratisch. Oder alles andere als das. Aber wenn man die Übersicht hat und lenken kann, wozu braucht man das dann noch. DÜL erfüllt unsere Sehnsüchte nach Sicherheit, Gewißheit, heiler Zukunft.
Und ich spürte sofort, daß wir alle genau diese brauchen. Eine Übersichtslenkung bringt uns dorthin, wohin wir wollen. Eine Deutsche Übersichtslenkung wäre gar in der Lage, die Regierung überflüssig zu machen. Es ist vielleicht nicht ganz demokratisch. Oder alles andere als das. Aber wenn man die Übersicht hat und lenken kann, wozu braucht man das dann noch. DÜL erfüllt unsere Sehnsüchte nach Sicherheit, Gewißheit, heiler Zukunft.
“Könnten wir auf das Ticket auch einen Slogan drucken?”
“Einen was?”
“Einen werbenden Spruch. Haben alle Unternehmen. So was wie: Die Bahn — wir bringen Sie hin. Oder: Mercedes — Ihr guter Stern auf allen Wegen. In der Art.”
“DÜL — Wir bringen Sie auf jeden Stern”, sagte Gustav.
 Einstweilen gibt es DÜL nur von Berlin Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof, und zwar in Wagen 6. Oder in sechs Wagen. Oder in einem über einer 6 schwebenden Waggon. DÜL legt sich da nicht fest. DÜL rechnet mit der Selbstdeutungskraft der Menschen. Aber man kommt mit DÜL gewiß übersichtlicher und gelenkter nach Köln als ohne.
Einstweilen gibt es DÜL nur von Berlin Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof, und zwar in Wagen 6. Oder in sechs Wagen. Oder in einem über einer 6 schwebenden Waggon. DÜL legt sich da nicht fest. DÜL rechnet mit der Selbstdeutungskraft der Menschen. Aber man kommt mit DÜL gewiß übersichtlicher und gelenkter nach Köln als ohne.
 Und für dieses sichere Gefühl, von DÜL gelenkt zu werden, das sich nur einstellt, wenn man das Ticket besitzt, muß man nur 2 Euro berappen. Das DÜL-Ticket kann man mitbestellen, wenn man etwas anderes ordert und natürlich direkt in der Werkstatt erwerben. DÜL ist einzigartig, DÜL gibt es nur hier. Und die Auflage ist limitiert, 30 Stück oder so. Wer zur deutschen Elite gehören will, kommt ohne das DÜL-Ticket nicht aus. Greifen Sie jetzt zu, schon morgen könnte es zu spät sein, und man muß sich die Beförderung durchs unübersichtliche Leben ungelenkt erschleichen bzw. die von Berlin Hbf. nach Köln Hbf. Und wenn man das Ticket als Postkarte benutzt, denn die Rückseite läßt sich sehr gut beschreiben, kann man einem anderen Menschen Übersicht und Lenkung verschaffen, ist das nicht herrlich?
Und für dieses sichere Gefühl, von DÜL gelenkt zu werden, das sich nur einstellt, wenn man das Ticket besitzt, muß man nur 2 Euro berappen. Das DÜL-Ticket kann man mitbestellen, wenn man etwas anderes ordert und natürlich direkt in der Werkstatt erwerben. DÜL ist einzigartig, DÜL gibt es nur hier. Und die Auflage ist limitiert, 30 Stück oder so. Wer zur deutschen Elite gehören will, kommt ohne das DÜL-Ticket nicht aus. Greifen Sie jetzt zu, schon morgen könnte es zu spät sein, und man muß sich die Beförderung durchs unübersichtliche Leben ungelenkt erschleichen bzw. die von Berlin Hbf. nach Köln Hbf. Und wenn man das Ticket als Postkarte benutzt, denn die Rückseite läßt sich sehr gut beschreiben, kann man einem anderen Menschen Übersicht und Lenkung verschaffen, ist das nicht herrlich?
— Martin Z. Schröder
Kommentare [3]
DÜL · 17. Mai 2009
 Als in dieser Woche meine jungen Schüler aus der benachbarten Grundschule wieder zu Besuch waren, stöhnte Gustav, er habe keine Idee. Dale setzte an seinem Buch, Johann eine Visitenkarte für seinen Vater, Freyja machte einen Linolschnitt, nur Gustav fiel nichts ein. Dann fiel ihm doch etwas ein. Und das gefällt mir so gut, daß ich ein wenig davon zeige. Ohne heute schon zu sagen, worum es sich handelt. Es wird großartig, dessen bin ich sicher.
Als in dieser Woche meine jungen Schüler aus der benachbarten Grundschule wieder zu Besuch waren, stöhnte Gustav, er habe keine Idee. Dale setzte an seinem Buch, Johann eine Visitenkarte für seinen Vater, Freyja machte einen Linolschnitt, nur Gustav fiel nichts ein. Dann fiel ihm doch etwas ein. Und das gefällt mir so gut, daß ich ein wenig davon zeige. Ohne heute schon zu sagen, worum es sich handelt. Es wird großartig, dessen bin ich sicher.
 Verbunden mit dieser Drucksache, einer klassischen Akzidenz, die zum Kunstwerk werden wird, ist die Gründung eines Unternehmens namens DÜL. Gustav hat auch ein Signet dazu entworfen. Ich habe die Drucksache auch noch einmal skizziert, weil ich Gustav beim nächsten Kurstermin kleine Änderungen im Entwurf vorschlagen möchte. Wie es der Zufall gut mit uns meint, bekam ich kürzlich erst die Schrift Saphir ins Haus.
Verbunden mit dieser Drucksache, einer klassischen Akzidenz, die zum Kunstwerk werden wird, ist die Gründung eines Unternehmens namens DÜL. Gustav hat auch ein Signet dazu entworfen. Ich habe die Drucksache auch noch einmal skizziert, weil ich Gustav beim nächsten Kurstermin kleine Änderungen im Entwurf vorschlagen möchte. Wie es der Zufall gut mit uns meint, bekam ich kürzlich erst die Schrift Saphir ins Haus.
 Die Pünktchen für Ä, Ö und Ü liegen gesondert bei, ich als Schriftsetzer soll mir nun aussuchen, wohin die Trema gesetzt werden?
Die Pünktchen für Ä, Ö und Ü liegen gesondert bei, ich als Schriftsetzer soll mir nun aussuchen, wohin die Trema gesetzt werden?
 Das ist keine Aufgabe für einen Schriftsetzer.
Das ist keine Aufgabe für einen Schriftsetzer.
 Und vielleicht überlasse ich diese Feinheit auch lieber Gustav.
Und vielleicht überlasse ich diese Feinheit auch lieber Gustav.
 So sieht’s ein bißchen falsch aus, aber interessant.
So sieht’s ein bißchen falsch aus, aber interessant.
 Das Firmenzeichen habe ich schon mal in Linoleum geschnitten. Ich weiß nicht, wie bedeutend DÜL in Zukunft sein wird, aber DÜL ist etwas, das jeder gut brauchen kann. Vor den Wahlen werden sich die Parteien um DÜL bemühen, aber auch jeder Wirtschaftskapitän würde sich freuen, ein wenig DÜL einsetzen zu dürfen. Und doch hat unser DÜL nur einen bestimmten, klar umrissenen Zweck und ist nur einmal gültig, dafür nach Belieben täglich, wenn man jemanden findet, der diesen Zweck erfüllt.
Das Firmenzeichen habe ich schon mal in Linoleum geschnitten. Ich weiß nicht, wie bedeutend DÜL in Zukunft sein wird, aber DÜL ist etwas, das jeder gut brauchen kann. Vor den Wahlen werden sich die Parteien um DÜL bemühen, aber auch jeder Wirtschaftskapitän würde sich freuen, ein wenig DÜL einsetzen zu dürfen. Und doch hat unser DÜL nur einen bestimmten, klar umrissenen Zweck und ist nur einmal gültig, dafür nach Belieben täglich, wenn man jemanden findet, der diesen Zweck erfüllt.
 An meinem Linolschnitt hab ich noch ein wenig korrigiert.
An meinem Linolschnitt hab ich noch ein wenig korrigiert.
 Leider ist mir die Spitze oben abgebrochen. Und das Band ist zu schmal geraten.
Leider ist mir die Spitze oben abgebrochen. Und das Band ist zu schmal geraten.
 Ich bin gespannt, ob Gustav meine Arbeit für DÜL akzeptiert oder es selbst versuchen wird. Es wird ein wenig dauern, bis ich weiter über DÜL berichten kann, denn kommende Woche fällt der Kurs aus Gründen aus. Wer DÜL einsetzt, kennt sogar diese Gründe.
Ich bin gespannt, ob Gustav meine Arbeit für DÜL akzeptiert oder es selbst versuchen wird. Es wird ein wenig dauern, bis ich weiter über DÜL berichten kann, denn kommende Woche fällt der Kurs aus Gründen aus. Wer DÜL einsetzt, kennt sogar diese Gründe.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [1]
Na endlich! · 7. Mai 2009
 Vor den Osterferien waren diese Karten von meinen jungen Schülern ja schon fertig, und ich hab es nicht geschafft, sie zu fotografieren für unser Angebot. Aber jetzt!
Vor den Osterferien waren diese Karten von meinen jungen Schülern ja schon fertig, und ich hab es nicht geschafft, sie zu fotografieren für unser Angebot. Aber jetzt!
 Die Druckerey ist stolz, die Arbeiten von Gustav, Freyja und Robert präsentieren zu dürfen, nämlich selbstgedichtete Gedichte selbstillustriert und selbstgedruckt in limitierter Auflage:
Die Druckerey ist stolz, die Arbeiten von Gustav, Freyja und Robert präsentieren zu dürfen, nämlich selbstgedichtete Gedichte selbstillustriert und selbstgedruckt in limitierter Auflage:
 Feuerwehr Ein 11-Worte-Gedicht von Gustav mit einem Linolschnitt von Robert.
Feuerwehr Ein 11-Worte-Gedicht von Gustav mit einem Linolschnitt von Robert.
 Wenn man beim Linolschnitt erst beim Andruck merkt, daß man eine Nachtaufnahme geschnitten hat, fügt man einfach Mond und Sterne hinzu.
Wenn man beim Linolschnitt erst beim Andruck merkt, daß man eine Nachtaufnahme geschnitten hat, fügt man einfach Mond und Sterne hinzu.
 Die Linien hat Gustav für handschriftliche Grüße vorgesehen.
Die Linien hat Gustav für handschriftliche Grüße vorgesehen.
 Wiese Noch ein 11-Worte-Gedicht (Elfchen genannt) von Gustav
Wiese Noch ein 11-Worte-Gedicht (Elfchen genannt) von Gustav
 mit einem Linolschnitt des Autors.
mit einem Linolschnitt des Autors.
 mit einem Linolschnitt von der Dichterin eigener Hand.
mit einem Linolschnitt von der Dichterin eigener Hand.
 Lieferung und Preis: 1,50 Euro brutto (also inkl. 19% MWSt.) per Stück inklusive gefüttertes Kuvert, 1,20 Euro ohne Kuvert. Keine Mindestabnahme. Verpackung und Versand: 4,00 Euro. Nur solange der Vorrat reicht, keine Nachdrucke, der Bleisatz ist abgelegt, es sind nur wenige Exemplare vorhanden, etwa 30 Stück.
Lieferung und Preis: 1,50 Euro brutto (also inkl. 19% MWSt.) per Stück inklusive gefüttertes Kuvert, 1,20 Euro ohne Kuvert. Keine Mindestabnahme. Verpackung und Versand: 4,00 Euro. Nur solange der Vorrat reicht, keine Nachdrucke, der Bleisatz ist abgelegt, es sind nur wenige Exemplare vorhanden, etwa 30 Stück.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [4]
Gußfrisch und frisch geschnitten · 20. April 2009
Derzeit ist so viel Betrieb in der Werkstatt, daß ich kaum Zeit finde, davon zu erzählen. Ich muß Notizen machen und später etwas nachholen.  Heute zeige ich zuerst noch eines der Ornamente aus Leipzig vom Druckkunstmuseum, das mir ausnehmend gut gefällt und das ich zusammen mit einer Schriftprobe gedruckt habe. Zwei beinahe gußfrische Grade der Compliment kaufte ich vor ein paar Wochen vom führenden deutschen (wenn nicht gar westauropäischen) Bleisatzhändler Georg Kraus. Es dauert immer eine Weile, bis die Schriften ausgepackt und in Setzkästen untergebracht sind und dann noch eine Weile, bis ich dazu komme, sie zu drucken. Aber nun waren der Reize zwei: Ornament und Schrift.
Heute zeige ich zuerst noch eines der Ornamente aus Leipzig vom Druckkunstmuseum, das mir ausnehmend gut gefällt und das ich zusammen mit einer Schriftprobe gedruckt habe. Zwei beinahe gußfrische Grade der Compliment kaufte ich vor ein paar Wochen vom führenden deutschen (wenn nicht gar westauropäischen) Bleisatzhändler Georg Kraus. Es dauert immer eine Weile, bis die Schriften ausgepackt und in Setzkästen untergebracht sind und dann noch eine Weile, bis ich dazu komme, sie zu drucken. Aber nun waren der Reize zwei: Ornament und Schrift.
 Nach Angaben von Georg Kraus wurde die Compliment von Helmut Matheis entworfen und erstmals 1965 von der Gießerei Ludwig & Mayer in Frankfurt gegossen. Diese Schrift hat nicht das Zeug zu einem Klassiker, es ist eine anständige Schreibschrift für Akzidenzen, die den Zeitgeist der 50er und 60er Jahre spiegelt, etwas altbacken, aber handwerklich gut gemacht. Mir gefällt eine gewisse Härte oder Schärfe in den deutlich kalligrafischen Zügen, die etwas manirierte Spitzigkeit.
Nach Angaben von Georg Kraus wurde die Compliment von Helmut Matheis entworfen und erstmals 1965 von der Gießerei Ludwig & Mayer in Frankfurt gegossen. Diese Schrift hat nicht das Zeug zu einem Klassiker, es ist eine anständige Schreibschrift für Akzidenzen, die den Zeitgeist der 50er und 60er Jahre spiegelt, etwas altbacken, aber handwerklich gut gemacht. Mir gefällt eine gewisse Härte oder Schärfe in den deutlich kalligrafischen Zügen, die etwas manirierte Spitzigkeit. 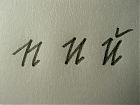 Die Schrift ist nicht originell, hat keine große Eleganz, und meinem Druckschüler Dale, der in den Ferien mal für zwei Stunden zur Arbeit an seinem Büchlein kam, fiel gleich der Haken auf dem u auf, worauf ich ihm die Herkunft dieses Diakritikums aus der deutschen Kurrent zeigte. Man kann in der Kurrent bis 1941 n und u ohne das Häkchen gar nicht unterscheiden. Voran steht noch das e der Kurrent, das den beiden andern Figuren ähnelt und den Schreiber so zur Sorgfalt zwingt.
Die Schrift ist nicht originell, hat keine große Eleganz, und meinem Druckschüler Dale, der in den Ferien mal für zwei Stunden zur Arbeit an seinem Büchlein kam, fiel gleich der Haken auf dem u auf, worauf ich ihm die Herkunft dieses Diakritikums aus der deutschen Kurrent zeigte. Man kann in der Kurrent bis 1941 n und u ohne das Häkchen gar nicht unterscheiden. Voran steht noch das e der Kurrent, das den beiden andern Figuren ähnelt und den Schreiber so zur Sorgfalt zwingt.
 Dale hat einen Linolschnitt gemacht, und falls die Zeichnung nicht zu erkennen ist: Wenn sie als Illustration in seinem Buch steht, wird man sofort sehen, worum es sich handelt. Er hat den Schnitt dann auch gleich gedruckt. Und ich freue mich sehr auf das fertige Büchlein. Eine Weile brauchen wir noch. Einstweilen zeige ich hier die Sammlung meiner
Dale hat einen Linolschnitt gemacht, und falls die Zeichnung nicht zu erkennen ist: Wenn sie als Illustration in seinem Buch steht, wird man sofort sehen, worum es sich handelt. Er hat den Schnitt dann auch gleich gedruckt. Und ich freue mich sehr auf das fertige Büchlein. Eine Weile brauchen wir noch. Einstweilen zeige ich hier die Sammlung meiner  Linolschnittmesser. Ich weiß nicht mehr, woher sie kommen. Ob ich sie 1972 schon als neu besaß oder später im DDR-Ausverkauf mitnahm. Die Messer selbst taugen wenig, sie sind einfach nicht scharf. Ich habe die hölzernen Halter mit Messern der Firma Brause ausgestattet. Dazwischen liegt noch ein Kunststoff-Messerhalter aus der DDR sowie ein Holz-Messerhalter von
Linolschnittmesser. Ich weiß nicht mehr, woher sie kommen. Ob ich sie 1972 schon als neu besaß oder später im DDR-Ausverkauf mitnahm. Die Messer selbst taugen wenig, sie sind einfach nicht scharf. Ich habe die hölzernen Halter mit Messern der Firma Brause ausgestattet. Dazwischen liegt noch ein Kunststoff-Messerhalter aus der DDR sowie ein Holz-Messerhalter von  heute. An der Verpackung gefällt mir der auf die Feder gestützte Bär mit der beeindruckenden Hüfte und dem halbkreisförmigen Bauch und den schlanken Füßen ausnehmend gut. Damals war Gebrauchsgrafik noch ein Handwerk auch des Zeichnens, und man hatte damals noch Freude an grafischen Zeichen. Der leider oft ausschließliche Computergebrauch hat die gebrauchsgrafische Sprache verflacht. Man sieht so viele
heute. An der Verpackung gefällt mir der auf die Feder gestützte Bär mit der beeindruckenden Hüfte und dem halbkreisförmigen Bauch und den schlanken Füßen ausnehmend gut. Damals war Gebrauchsgrafik noch ein Handwerk auch des Zeichnens, und man hatte damals noch Freude an grafischen Zeichen. Der leider oft ausschließliche Computergebrauch hat die gebrauchsgrafische Sprache verflacht. Man sieht so viele  Stilisierungen und stilisierte Zeichen, daß es schon nur noch geometrische Zeichen sind, und sie sind allesamt leicht zu verwechseln, ob sie nun an Finanzinstituten pappen oder an Hygienepapierfabriken. Dieser Linolschnittmesserherstellerbär zeigt freundliche, lässige Selbstironie. Das ist den heutigen Zeichen fremd. Vielleicht weil der Konsum wichtiger genommen wird und Marken zu Ikonen geworden sind?
Stilisierungen und stilisierte Zeichen, daß es schon nur noch geometrische Zeichen sind, und sie sind allesamt leicht zu verwechseln, ob sie nun an Finanzinstituten pappen oder an Hygienepapierfabriken. Dieser Linolschnittmesserherstellerbär zeigt freundliche, lässige Selbstironie. Das ist den heutigen Zeichen fremd. Vielleicht weil der Konsum wichtiger genommen wird und Marken zu Ikonen geworden sind?
— Martin Z. Schröder
Kommentare [2]
Nachtrag zur Schulpause · 5. April 2009
 Diese beiden Arbeiten hatt ich gestern zu zeigen vergessen. Gustav war so freundlich, eine Reklamekarte für meine Druckerei zu texten, zu entwerfen und zu drucken. Und: “Du darfst sie verteilen.” Es ist nicht recht mein Stil, durch die Straßen zu gehen und auf diese Art Reklame zu machen, zumal ich sie nicht brauche. Aber es ist eine ausgezeichnete Beigabe für die Postkarten, die ich in den kommenden Tagen hoffentlich hier anbieten kann.
Diese beiden Arbeiten hatt ich gestern zu zeigen vergessen. Gustav war so freundlich, eine Reklamekarte für meine Druckerei zu texten, zu entwerfen und zu drucken. Und: “Du darfst sie verteilen.” Es ist nicht recht mein Stil, durch die Straßen zu gehen und auf diese Art Reklame zu machen, zumal ich sie nicht brauche. Aber es ist eine ausgezeichnete Beigabe für die Postkarten, die ich in den kommenden Tagen hoffentlich hier anbieten kann.
 Freyja hatte die ausgezeichnete Idee, Etiketten für ihr Bücherregal zu drucken und mit dieser Hilfe ihre Bibliothek neu zu ordnen.
Freyja hatte die ausgezeichnete Idee, Etiketten für ihr Bücherregal zu drucken und mit dieser Hilfe ihre Bibliothek neu zu ordnen.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [3]
Schulpause · 4. April 2009
 In dieser Woche fand der letzte Kurs vor den Ferien statt. In drei Wochen geht es weiter, dann in etwas veränderter Besetzung. Und bis dahin werde ich die Postkarten meiner Schüler fotografiert und hier angeboten haben. Beim letzten Termin hat Freya ihre Ostergeschenkanhänger fertig gedruckt, Robert noch Visitenkarten für die Großeltern angefertigt und einen
In dieser Woche fand der letzte Kurs vor den Ferien statt. In drei Wochen geht es weiter, dann in etwas veränderter Besetzung. Und bis dahin werde ich die Postkarten meiner Schüler fotografiert und hier angeboten haben. Beim letzten Termin hat Freya ihre Ostergeschenkanhänger fertig gedruckt, Robert noch Visitenkarten für die Großeltern angefertigt und einen  kleinen Text mit dem alten Druckstock zweier Rosen illustriert, Gustav hat eine zweifarbige Werbekarte für meine Werkstatt fertiggestellt, Annalisa hat gezeichnet und kalligrafiert, und der tapfere Dale hat an seinem Buch weitergemacht: eine Seite gesetzt und eine Doppelseite gedruckt. Erst jetzt, da ich die Bilder sehe, fällt mir auf, daß Dale ohne Schuhe durch die Werkstatt
kleinen Text mit dem alten Druckstock zweier Rosen illustriert, Gustav hat eine zweifarbige Werbekarte für meine Werkstatt fertiggestellt, Annalisa hat gezeichnet und kalligrafiert, und der tapfere Dale hat an seinem Buch weitergemacht: eine Seite gesetzt und eine Doppelseite gedruckt. Erst jetzt, da ich die Bilder sehe, fällt mir auf, daß Dale ohne Schuhe durch die Werkstatt  spaziert ist. Das kommt nicht noch mal vor. Zwar arbeiten die Lehrlinge nicht mit der Ahle, aber sie kann ja mir aus der Hand gleiten, wenn sie neben mir stehen. Es ist auch nicht angenehm, wenn einem ein Bleisteg aus einem Meter Höhe auf den lediglich bestrumpften Fuß donnert. Ohne Schuhe in der Bleisetzerei, die Idee ist ja so abwegig, daß ich deshalb gar nicht auf die Idee kam, feste Fußbekleidung extra anzuordnen. Es sieht natürlich auch gemütlich aus, und wenn es meine Gäste in meiner Werkstatt gemütlich finden, gefällt es mir auch.
spaziert ist. Das kommt nicht noch mal vor. Zwar arbeiten die Lehrlinge nicht mit der Ahle, aber sie kann ja mir aus der Hand gleiten, wenn sie neben mir stehen. Es ist auch nicht angenehm, wenn einem ein Bleisteg aus einem Meter Höhe auf den lediglich bestrumpften Fuß donnert. Ohne Schuhe in der Bleisetzerei, die Idee ist ja so abwegig, daß ich deshalb gar nicht auf die Idee kam, feste Fußbekleidung extra anzuordnen. Es sieht natürlich auch gemütlich aus, und wenn es meine Gäste in meiner Werkstatt gemütlich finden, gefällt es mir auch.
Auf diesem Bild sieht man zwei Zeilen in Dales Winkelhaken. Er wollte heute aus der Legende setzen,  der schönen Schreibschrift von Ernst Schneidler, die im Schriftgrad Tertia (16p) im Steckschriftkasten untergebracht ist. “Gibt es dafür keine Bedienungsanleitung?” Dem Anfänger erscheint der alphabetisch geordnete Steckschriftkasten erst einmal einfacher als der Kasten, in dem die Schriften nach dem Turmino-Schema der Häufigkeit liegen. Wer aber am Setzkasten schon auf Tempo kommt, der findet den Steckschriftkasten erst einmal mühseliger, denn man muß nach dem Alphabet die Buchstaben abzählen.
der schönen Schreibschrift von Ernst Schneidler, die im Schriftgrad Tertia (16p) im Steckschriftkasten untergebracht ist. “Gibt es dafür keine Bedienungsanleitung?” Dem Anfänger erscheint der alphabetisch geordnete Steckschriftkasten erst einmal einfacher als der Kasten, in dem die Schriften nach dem Turmino-Schema der Häufigkeit liegen. Wer aber am Setzkasten schon auf Tempo kommt, der findet den Steckschriftkasten erst einmal mühseliger, denn man muß nach dem Alphabet die Buchstaben abzählen.
Wir haben uns dann noch über die Kalkulation eines Verkaufspreises unterhalten für das Büchlein von Dale. Ich kann versichern, daß es sehr hübsch wird. Und daß wir keinen realen Preis dafür werden verlangen können, ist uns bewußt. Die Auflage liegt bei 50 Exemplaren. Wenn allerdings mein junger Schriftsetzer- und Druckerschüler Dale eines fernen Tages in irgend einer Profession berühmt werden sollte (er dichtet nicht nur, er singt auch Oper), wird dieses Büchlein einen hübschen Handelswert bekommen. Mir ist es jetzt schon teuer, denn Dale macht es mit Freude und Mühe, und diese Mixtur ist unbezahlbar.
 Ausnehmend gut gefällt mir, daß meine neue Glasvase mit der Sonne so elegante weiße und blaue Streifen an die Wand malt.
Ausnehmend gut gefällt mir, daß meine neue Glasvase mit der Sonne so elegante weiße und blaue Streifen an die Wand malt.
— Martin Z. Schröder
Alliterationen und Ostervorbereitung · 30. März 2009
 Ich habe, Ehrenwort, nichts damit zu tun, daß sich meine Schüler ein paar lyrische Formen zu eigen machen. Ich hab gar keine Zeit, mit ihnen darüber zu reden, weil ich ziemlich auf Trab gehalten werde, die technischen Voraussetzungen zu schaffen und Hilfen zu geben. Die Maschine einzurichten bleibt bislang meine erste Aufgabe. Diesmal hatten Dale und Robert mit Tautogrammen angefangen.
Ich habe, Ehrenwort, nichts damit zu tun, daß sich meine Schüler ein paar lyrische Formen zu eigen machen. Ich hab gar keine Zeit, mit ihnen darüber zu reden, weil ich ziemlich auf Trab gehalten werde, die technischen Voraussetzungen zu schaffen und Hilfen zu geben. Die Maschine einzurichten bleibt bislang meine erste Aufgabe. Diesmal hatten Dale und Robert mit Tautogrammen angefangen.
 Dale denkt sich manche Texte erst beim Setzen aus, glaube ich. Und er ist wirklich gut darin, wie man an diesem Gedicht sehen kann, das erst noch gedruckt werden muß. Neulich guckte er sich die Stapel von Karten an, welche die anderen gedruckt hatten, mit den Linolschnitten. Und meinte, er hätte vielleicht doch auch so etwas machen sollen, so viele verschiedene kleine Dinge. Worauf ich versetzte, er liege mit seinem Büchlein genau richtig, er werde sich, nicht erst wenn er so alt sei wie ich, aber dann besonders, ein Loch in den Bauch freuen über dieses Büchlein mit den eigenen Gedichten. Ob das ein Trost ist? Man kann sich mit zehn Jahren wohl kaum vorstellen, dreißig Jahre älter zu sein. Aber es ist ja die Wahrheit, also was soll ich sonst sagen? (Ich kann mir übrigens auch nicht vorstellen, dreißig Jahre älter zu sein, fällt mir dabei ein.)
Dale denkt sich manche Texte erst beim Setzen aus, glaube ich. Und er ist wirklich gut darin, wie man an diesem Gedicht sehen kann, das erst noch gedruckt werden muß. Neulich guckte er sich die Stapel von Karten an, welche die anderen gedruckt hatten, mit den Linolschnitten. Und meinte, er hätte vielleicht doch auch so etwas machen sollen, so viele verschiedene kleine Dinge. Worauf ich versetzte, er liege mit seinem Büchlein genau richtig, er werde sich, nicht erst wenn er so alt sei wie ich, aber dann besonders, ein Loch in den Bauch freuen über dieses Büchlein mit den eigenen Gedichten. Ob das ein Trost ist? Man kann sich mit zehn Jahren wohl kaum vorstellen, dreißig Jahre älter zu sein. Aber es ist ja die Wahrheit, also was soll ich sonst sagen? (Ich kann mir übrigens auch nicht vorstellen, dreißig Jahre älter zu sein, fällt mir dabei ein.)
 Freya druckte ein Osterei vom Linoleum, das sie eine Woche zuvor geschnitten hatte.
Freya druckte ein Osterei vom Linoleum, das sie eine Woche zuvor geschnitten hatte.
 Und danach gleich noch einen Dreizeiler, zu dem sie einen neuen Linolschnitt machte. Für nächstes Mal. Annalisa hat Osterkarten handcoloriert, ich zeige demnächst welche, sie sind sehr schön geworden! Und Gustav fehlte. Er hätte mir bestimmt Dampf gemacht, weil ich die fertigen Karten noch nicht hier angeboten habe. Bald, bald!
Und danach gleich noch einen Dreizeiler, zu dem sie einen neuen Linolschnitt machte. Für nächstes Mal. Annalisa hat Osterkarten handcoloriert, ich zeige demnächst welche, sie sind sehr schön geworden! Und Gustav fehlte. Er hätte mir bestimmt Dampf gemacht, weil ich die fertigen Karten noch nicht hier angeboten habe. Bald, bald!
— Martin Z. Schröder
Kommentare [1]
Römische Abgelatschte · 29. März 2009
 Es ist eine ganze Weile her, ich habe es aber nicht vergessen, daß ich noch abschließend etwas zur Romana sagen wollte. Mein Druck- und Satzschüler Dale möchte immerzu neue Schriften für sein Büchlein setzen, ich kann ihm als Anfänger aber noch nicht alle geben, also habe ich geschaut, was noch an weniger empfindlichen Schriften vorhanden ist und eine “Römische Antiqua” gefunden.
Es ist eine ganze Weile her, ich habe es aber nicht vergessen, daß ich noch abschließend etwas zur Romana sagen wollte. Mein Druck- und Satzschüler Dale möchte immerzu neue Schriften für sein Büchlein setzen, ich kann ihm als Anfänger aber noch nicht alle geben, also habe ich geschaut, was noch an weniger empfindlichen Schriften vorhanden ist und eine “Römische Antiqua” gefunden.
 Dale hat ein Gedicht daraus gesetzt, und im ersten Abzug haben wir dann die Bescherung gesehen: die Schrift ist völlig fertig. Abgenudelt, ausgelatscht, runtergetreten, abgequetscht und auch noch ausgelutscht. Da ist nichts mehr zu machen. Schrott. Der Kasten ist auch noch verfischt und verzwiebelfischt! Wir haben ein paar Buchstaben ausgewechselt und mit viel Druck und Farbe eine lesbare Seite hinbekommen.
Dale hat ein Gedicht daraus gesetzt, und im ersten Abzug haben wir dann die Bescherung gesehen: die Schrift ist völlig fertig. Abgenudelt, ausgelatscht, runtergetreten, abgequetscht und auch noch ausgelutscht. Da ist nichts mehr zu machen. Schrott. Der Kasten ist auch noch verfischt und verzwiebelfischt! Wir haben ein paar Buchstaben ausgewechselt und mit viel Druck und Farbe eine lesbare Seite hinbekommen.
 Was mache ich mit der Schrift? Aufbewahren, falls jemand authentischen Schrott gedruckt haben möchte? Vielleicht für Schmuckflächen aus Buchstaben, so experimentelle Typografie? Oder wegkippen und den Kasten für eine Schrift nutzen, die noch verpackt ist und mangels Setzkasten nicht zum Einsatz kommen kann?
Was mache ich mit der Schrift? Aufbewahren, falls jemand authentischen Schrott gedruckt haben möchte? Vielleicht für Schmuckflächen aus Buchstaben, so experimentelle Typografie? Oder wegkippen und den Kasten für eine Schrift nutzen, die noch verpackt ist und mangels Setzkasten nicht zum Einsatz kommen kann?
— Martin Z. Schröder
Kommentare [2]
Fettes Grün · 15. März 2009
Die jungen Drucker waren wieder in der Werkstatt. Ich hatte schon die Maschine eingerichtet  für einen neuen Druckbogen des Büchleins von Dale, damit wir damit vorankommen, aber der Knabe fehlte. Ich hoffe, es ist nicht schlimmer als ein Schnupfen! Nun sammelten sich ja auch die Linolschnitte, und da die Maschine gerade geputzt war und wir uns eine Farbe aussuchen konnte, fiel die Entscheidung für ein kräftiges Grün, mehr oder weniger dunkel.
für einen neuen Druckbogen des Büchleins von Dale, damit wir damit vorankommen, aber der Knabe fehlte. Ich hoffe, es ist nicht schlimmer als ein Schnupfen! Nun sammelten sich ja auch die Linolschnitte, und da die Maschine gerade geputzt war und wir uns eine Farbe aussuchen konnte, fiel die Entscheidung für ein kräftiges Grün, mehr oder weniger dunkel.
 Robert hat flugs in sein Bild, das auf die Rückseite von Gustavs “Feuer”-Karte gedruckt werden sollte und schon aufgeklebt war, Mond und Sterne geschnitten.
Robert hat flugs in sein Bild, das auf die Rückseite von Gustavs “Feuer”-Karte gedruckt werden sollte und schon aufgeklebt war, Mond und Sterne geschnitten.
 Gustav fertigte derweil die Illustration für sein Wiesen-Gedicht an. Als er fast fertig war, beim letzten Schnitt, flitzte das Messer doch in den Finger, den ich so vorschriftsmäßig verpflasterte, daß ein Chefarzt mich zum Assistenten gemacht hätte, es war nur keiner in der Nähe, und ich hab ja auch anderes zu tun. Das Arbeitsgerät meines Kollegen Helmut Bohlmann erweist sich aber als sehr hilfreich — ich bin froh, daß wir es haben.
Gustav fertigte derweil die Illustration für sein Wiesen-Gedicht an. Als er fast fertig war, beim letzten Schnitt, flitzte das Messer doch in den Finger, den ich so vorschriftsmäßig verpflasterte, daß ein Chefarzt mich zum Assistenten gemacht hätte, es war nur keiner in der Nähe, und ich hab ja auch anderes zu tun. Das Arbeitsgerät meines Kollegen Helmut Bohlmann erweist sich aber als sehr hilfreich — ich bin froh, daß wir es haben.
 Hier eine kleine Übersicht. Die Besucher sind so fleißig, daß ich kaum nachkomme, alle Fragen zu beantworten und Werkzeuge zu liefern und zu helfen. Wir könnten zwei Maschinen bestücken. Aber das würde mir zu unübersichtlich.
Hier eine kleine Übersicht. Die Besucher sind so fleißig, daß ich kaum nachkomme, alle Fragen zu beantworten und Werkzeuge zu liefern und zu helfen. Wir könnten zwei Maschinen bestücken. Aber das würde mir zu unübersichtlich.
 Das Haus von Freyja. Ist auch heute gedruckt worden und …
Das Haus von Freyja. Ist auch heute gedruckt worden und …
 … sieht so schön aus. Ich mache noch mal Fotos, wenn wir eine Übersicht haben, was wir in welcher Menge in den Verkauf geben.
… sieht so schön aus. Ich mache noch mal Fotos, wenn wir eine Übersicht haben, was wir in welcher Menge in den Verkauf geben.
 Annalisa schnitt und druckte Sonne-Mond-und-Sterne ohne Sonne; meinem schwachen Gedächtnis ist schon wieder entglitten, wofür es sein wird.
Annalisa schnitt und druckte Sonne-Mond-und-Sterne ohne Sonne; meinem schwachen Gedächtnis ist schon wieder entglitten, wofür es sein wird.
 Das ist die Illustration von Gustav für sein Wiesengedicht.
Das ist die Illustration von Gustav für sein Wiesengedicht.
 Ich wandte gegen die Position ein, daß man die Karte so nicht als Postkarte verwenden könne. Gustav meinte, daß man erstens rechts oben noch eine Briefmarke und unter das Bild eine Adresse schreiben könne und zweitens ebensogut die Karte im Kuvert verschicken. Diese Erklärung hielten Freyja, Annalisa und Robert für überzeugend, und meine Skepsis wurde für nicht schlagkräftig genug erklärt, die Sache zu ändern.
Ich wandte gegen die Position ein, daß man die Karte so nicht als Postkarte verwenden könne. Gustav meinte, daß man erstens rechts oben noch eine Briefmarke und unter das Bild eine Adresse schreiben könne und zweitens ebensogut die Karte im Kuvert verschicken. Diese Erklärung hielten Freyja, Annalisa und Robert für überzeugend, und meine Skepsis wurde für nicht schlagkräftig genug erklärt, die Sache zu ändern.
Also druckte Gustav die Wiesenkarte. Und nächstes Mal, wenn die Farbe trocken ist (das dauert mindestens eine Woche), wird auf eine Karte noch mit einer zweiten Farbe gedruckt und sprechen wir über den Verkaufspreis, so daß ich die Karten bald offerieren kann.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [2]
Kartendruck, Berechnungen, Hunger · 8. März 2009
Ob meine verehrten Leser das Druckerey-Blog derzeit zu unterrichtsschwer finden? Aber die anderen Themen laufen mir nicht weg. Von meinen Schülern muß ich gleich berichten, weil ich sonst vergesse, wie es gewesen ist. Wir werden beizeiten auch wieder auf andere Dinge zu sprechen kommen. Gustav, der altersbedingter Kürze wegen an der Presse auf zwei Kisten steht (Foto), war sehr angetan, als ich ihm auf dem Weg von der Schule zur Werkstatt von der Ankündigung der ersten Bestellung seiner Kunstpostkarten erzählte.
Aber die anderen Themen laufen mir nicht weg. Von meinen Schülern muß ich gleich berichten, weil ich sonst vergesse, wie es gewesen ist. Wir werden beizeiten auch wieder auf andere Dinge zu sprechen kommen. Gustav, der altersbedingter Kürze wegen an der Presse auf zwei Kisten steht (Foto), war sehr angetan, als ich ihm auf dem Weg von der Schule zur Werkstatt von der Ankündigung der ersten Bestellung seiner Kunstpostkarten erzählte.
Der Drucker mit eigener Werkstatt ist nicht nur Handwerker, er ist auch Kaufmann, und nachdem ich durchblicken ließ, daß die Werkstatt durch kaufmännisches  Verhalten zusammengehalten wird, fanden Gustav und Dale Interesse an der Kalkulation der Karten. Denn neben Gustav, der als Dichter, Schriftsetzer und Drucker drei Funktionen ausfüllt, stehen dem Werkstattbesitzer und Verleger (also mir) und dem Illustrator Robert mit seinem Linolschnitt Anteile am Verkaufserlös zu. Daß die Sache nicht so ganz durch drei teilbar sein sollte, weil sich damit ungerechter Ausgleich der Leistung verbände, war den Jungen schnell deutlich geworden. Wir besprachen diverse Modelle der Aufteilung — und niemand sagte: In Mathe bin ich nicht so gut. Isses nicht seltsam? Vergnügen bereitet mir die unternehmerische Auffassung der Sache. Es geht den Kindern ebenso wie mir nicht darum, viel Geld zu verdienen, sondern einen freundlichen Kreislauf zu konstruieren, der alle Beteiligten angemessen behandelt und Spaß macht. Wir besprechen, was ein Produkt ist, das begehrt werden könnte, wir drucken eines, das uns gefällt, wir freuen uns über Interesse, und wir werden einfach ausprobieren, was wir phantasieren.
Verhalten zusammengehalten wird, fanden Gustav und Dale Interesse an der Kalkulation der Karten. Denn neben Gustav, der als Dichter, Schriftsetzer und Drucker drei Funktionen ausfüllt, stehen dem Werkstattbesitzer und Verleger (also mir) und dem Illustrator Robert mit seinem Linolschnitt Anteile am Verkaufserlös zu. Daß die Sache nicht so ganz durch drei teilbar sein sollte, weil sich damit ungerechter Ausgleich der Leistung verbände, war den Jungen schnell deutlich geworden. Wir besprachen diverse Modelle der Aufteilung — und niemand sagte: In Mathe bin ich nicht so gut. Isses nicht seltsam? Vergnügen bereitet mir die unternehmerische Auffassung der Sache. Es geht den Kindern ebenso wie mir nicht darum, viel Geld zu verdienen, sondern einen freundlichen Kreislauf zu konstruieren, der alle Beteiligten angemessen behandelt und Spaß macht. Wir besprechen, was ein Produkt ist, das begehrt werden könnte, wir drucken eines, das uns gefällt, wir freuen uns über Interesse, und wir werden einfach ausprobieren, was wir phantasieren.
 Dabei rechnen wir übrigens viel nebenbei, das heißt oft rechne ich alleine, wenn es schnell gehen soll und die fixe Kopfrechnerin Freyja gerade nicht in der Nähe ist, aber heute haben wir doch das Duodezimalsystem und die Vor- und Nachteile von 10 und 12 so nebenbei besprochen. Ich habe Dale auch schon mal die Villardsche Figur gezeigt für den Seitenaufriß seines Buches, demnächst werden wir das genauer besprechen, da meine Schüler an allem sehr interessiert sind. Punkt, Cicero und Konkordanz sind nun eingeführte Begriffe, schade ist nur, daß man sie ausschließlich in der Druckerei alten Stils verwenden kann. Und wir haben uns damit befaßt, daß etwas übrigbleibt, wenn man etwas mit ganzen Zahlen drittelt.
Dabei rechnen wir übrigens viel nebenbei, das heißt oft rechne ich alleine, wenn es schnell gehen soll und die fixe Kopfrechnerin Freyja gerade nicht in der Nähe ist, aber heute haben wir doch das Duodezimalsystem und die Vor- und Nachteile von 10 und 12 so nebenbei besprochen. Ich habe Dale auch schon mal die Villardsche Figur gezeigt für den Seitenaufriß seines Buches, demnächst werden wir das genauer besprechen, da meine Schüler an allem sehr interessiert sind. Punkt, Cicero und Konkordanz sind nun eingeführte Begriffe, schade ist nur, daß man sie ausschließlich in der Druckerei alten Stils verwenden kann. Und wir haben uns damit befaßt, daß etwas übrigbleibt, wenn man etwas mit ganzen Zahlen drittelt.
 Ich verfolge dabei keine Ziele im Sinne von Trichterwissen, sondern ich bevorzuge die gedankliche Bewegung, die den eigenen individuellen Interessen folgt. Bei Montaigne heißt es: Wer führen will, muß folgen. Ich schlage vor, zeige, rege an, aber ich verlange kein Interesse. Das habe ich selbst als Schüler immer abwegig gefunden. Interesse kann nur gelockt werden, aber man kann es nicht herbeizerren. Zwang, den gibt es auch, aber er kommt allein aus der Materie, denn wir arbeiten nach alten Regeln und Gesetzen des Handwerks, deren Sinn ich darlegen kann, und nun lernen die Schüler so nebenbei: Wer das Handwerk führen will, muß seinen Regeln folgen.
Ich verfolge dabei keine Ziele im Sinne von Trichterwissen, sondern ich bevorzuge die gedankliche Bewegung, die den eigenen individuellen Interessen folgt. Bei Montaigne heißt es: Wer führen will, muß folgen. Ich schlage vor, zeige, rege an, aber ich verlange kein Interesse. Das habe ich selbst als Schüler immer abwegig gefunden. Interesse kann nur gelockt werden, aber man kann es nicht herbeizerren. Zwang, den gibt es auch, aber er kommt allein aus der Materie, denn wir arbeiten nach alten Regeln und Gesetzen des Handwerks, deren Sinn ich darlegen kann, und nun lernen die Schüler so nebenbei: Wer das Handwerk führen will, muß seinen Regeln folgen.
 Gustav hatte letztens schon das Gedicht für seine zweite Postkarte zu setzen begonnen, stellte die Arbeit heute fertig und druckte die Karte.
Gustav hatte letztens schon das Gedicht für seine zweite Postkarte zu setzen begonnen, stellte die Arbeit heute fertig und druckte die Karte.
Ich bin von diesem Text begeistert. Herrlich! Wir sind am Nachmittag knapp drei Stunden zugange. Neulich verkündete jemand einfach so: “Ich habe Hunger.” Also darauf war ich nicht eingerichtet. Erwachsene Leute hätten sich vielleicht Proviant mitgebracht.  Nun ja, es ist aber auch recht bequem, wenn man Menschen um sich hat, die einen präzise wissen lassen, wie sie sich fühlen. Ich hatte diesmal ein paar Kekse beschafft, dies wurde sehr gewürdigt. Freyja war aber so in ihre Arbeit vertieft (sie druckte jetzt auch eine Postkarte, und zwar mit einem eigenen Linolschnitt), daß sie keine Lust hatte, sich dafür die Hände zu waschen (Blei ist giftig), also habe ich ihr, damit sie sich nicht immerzu von den Kollegen mit gewaschenen Händen füttern lassen muß, dieses Hilfsmittel gezeigt (Bild).
Nun ja, es ist aber auch recht bequem, wenn man Menschen um sich hat, die einen präzise wissen lassen, wie sie sich fühlen. Ich hatte diesmal ein paar Kekse beschafft, dies wurde sehr gewürdigt. Freyja war aber so in ihre Arbeit vertieft (sie druckte jetzt auch eine Postkarte, und zwar mit einem eigenen Linolschnitt), daß sie keine Lust hatte, sich dafür die Hände zu waschen (Blei ist giftig), also habe ich ihr, damit sie sich nicht immerzu von den Kollegen mit gewaschenen Händen füttern lassen muß, dieses Hilfsmittel gezeigt (Bild).
 Freyja fragte mich, ob ich einen kleinen Vogel habe. Klar. Hab ich. Siehe Foto.
Freyja fragte mich, ob ich einen kleinen Vogel habe. Klar. Hab ich. Siehe Foto.
Die Arbeit von Dale darf ich nicht zeigen, denn es wird eine Überraschung. Er hat sich ja viel vorgenommen mit seinem Buch. Heute haben wir den ersten Bogen gedruckt, wofür wir den Umfang des Büchleins planen und berechnen mußten, bevor wir Papier schneiden konnten. Es wird 16 Seiten haben, also vier Druckbogen à vier Seiten. Ich sollte demnächst vom Buchdrucker der Inkunabelzeit erzählen, der auch ein Verleger war, und manchmal auch ein Autor.
 Meine Schüler sind wirklich liebenswürdig: Zum Schluß wurde mir dieser von Annalisa kalligrafierte Zettel überreicht. Gustavs Signatur fehlt, weil er früher gehen mußte. Robert konnte gar nicht kommen wegen Schnupfen. Die Auswirkungen der Rechtschreibreform zu bewerten, überlasse ich dem Betrachter. Ich hab mich sehr gefreut über das Kompliment.
Meine Schüler sind wirklich liebenswürdig: Zum Schluß wurde mir dieser von Annalisa kalligrafierte Zettel überreicht. Gustavs Signatur fehlt, weil er früher gehen mußte. Robert konnte gar nicht kommen wegen Schnupfen. Die Auswirkungen der Rechtschreibreform zu bewerten, überlasse ich dem Betrachter. Ich hab mich sehr gefreut über das Kompliment.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [8]
Arbeitshilfe aus Hamburg · 6. März 2009
 Neulich berichtete ich davon, daß sich mein Druckerey-Schüler Robert beim Linolschnitt zweimal in die Finger geschnitten hat. Das las mein mitfühlender Schriftsetzer-Kollege Helmut Bohlmann aus der Offizin des Museums für Arbeit in Hamburg und steckte umgehend eine Arbeitshilfe in die Post: ein Brett, das von aufgenagelten Leisten umrahmt wird, zwischen die man das zu bearbeitende Linoleum legt. Es kann so nicht mehr wegrutschen, auch ohne daß man es direkt festhält.
Neulich berichtete ich davon, daß sich mein Druckerey-Schüler Robert beim Linolschnitt zweimal in die Finger geschnitten hat. Das las mein mitfühlender Schriftsetzer-Kollege Helmut Bohlmann aus der Offizin des Museums für Arbeit in Hamburg und steckte umgehend eine Arbeitshilfe in die Post: ein Brett, das von aufgenagelten Leisten umrahmt wird, zwischen die man das zu bearbeitende Linoleum legt. Es kann so nicht mehr wegrutschen, auch ohne daß man es direkt festhält.
 Unten hat das Brett auch eine Leiste, die man gegen die Tischkante legt, so daß auch das Brett die Position hält. Ich hatte von solch praktischem Ding schon gehört, es aber nie zuvor gesehen. Ich hab mir früher selbst in die Finger geritzt, ich mache so selten Linolschnitt. Aber bei meinen jungen Gästen erfreut sich diese Technik nicht zuletzt dank meiner sehr scharfen Messer wachsender Beliebtheit. Jetzt wird alles anders: besser!
Unten hat das Brett auch eine Leiste, die man gegen die Tischkante legt, so daß auch das Brett die Position hält. Ich hatte von solch praktischem Ding schon gehört, es aber nie zuvor gesehen. Ich hab mir früher selbst in die Finger geritzt, ich mache so selten Linolschnitt. Aber bei meinen jungen Gästen erfreut sich diese Technik nicht zuletzt dank meiner sehr scharfen Messer wachsender Beliebtheit. Jetzt wird alles anders: besser!
Ich danke herzlich für dieses hilfreiche Arbeitsgerät!
— Martin Z. Schröder
Kommentare [1]
Ratte zu Gast · 3. März 2009
 Das Drucken mit der jungen Jugend geht freilich weiter. Wir hatten nun den dritten Termin, acht sind es in diesem Kurs insgesamt. Ob wir dann den Kurs weiterführen und in welcher Besetzung, entscheiden wir, wenn wir mit dem ersten fertig sind. Bislang sind meine Gäste noch fleißig und mit Freude zugange. Gustav erwies der Druckerey die Ehre, seine Ratte mitzubringen. Ein
Das Drucken mit der jungen Jugend geht freilich weiter. Wir hatten nun den dritten Termin, acht sind es in diesem Kurs insgesamt. Ob wir dann den Kurs weiterführen und in welcher Besetzung, entscheiden wir, wenn wir mit dem ersten fertig sind. Bislang sind meine Gäste noch fleißig und mit Freude zugange. Gustav erwies der Druckerey die Ehre, seine Ratte mitzubringen. Ein  geschecktes Tier, das mich an eine Hyäne erinnert. Blaue Schlitzaugen und Pranken wie ein Maulwurf. Sehr still saß es auf dem Setzkasten und betrachtete aufmerksam das Treiben seines Herrn. Welcher erst einmal eine Weile mit Nachdenken beschäftigt war und sich dann entschloß, ein Geschäft mit feinen Postkarten zu gründen. Er dichtete ein Gedicht, setzte dieses aus der
geschecktes Tier, das mich an eine Hyäne erinnert. Blaue Schlitzaugen und Pranken wie ein Maulwurf. Sehr still saß es auf dem Setzkasten und betrachtete aufmerksam das Treiben seines Herrn. Welcher erst einmal eine Weile mit Nachdenken beschäftigt war und sich dann entschloß, ein Geschäft mit feinen Postkarten zu gründen. Er dichtete ein Gedicht, setzte dieses aus der  Garamond ab, hieß mich zwei Linien hinzuzufügen für handschriftliche Ergänzungen des Postkartenbenutzers, trat in Urheberrechtsverhandlungen über die Nutzung des letztes Mal fertiggestellten Linolschnittes von Robert für die Rückseite und druckte eine recht ordentliche Auflage der Vorderseite, für deren Verkauf er mir die Hälfte seiner Einnahmen zusicherte. Nächstes Mal werden wir der zu illustrierenden Rückseite nähertreten. Von der Einbeziehung des Fachhandels habe ich abgeraten, weil der Gewinn im Direktvertrieb höher ist. Und wenn Gustav nur 50 Cent pro Karte im Verkauf nehmen will, können wir den Einzelhandel daran nicht partizipieren lassen. Dale war der Meinung, der Preis sei zu niedrig, und ich wies daraufhin, daß man im Schreibwarengeschäft für eine so aufwendig gedruckte Karte locker 3 Euro zu zahlen hätte.
Garamond ab, hieß mich zwei Linien hinzuzufügen für handschriftliche Ergänzungen des Postkartenbenutzers, trat in Urheberrechtsverhandlungen über die Nutzung des letztes Mal fertiggestellten Linolschnittes von Robert für die Rückseite und druckte eine recht ordentliche Auflage der Vorderseite, für deren Verkauf er mir die Hälfte seiner Einnahmen zusicherte. Nächstes Mal werden wir der zu illustrierenden Rückseite nähertreten. Von der Einbeziehung des Fachhandels habe ich abgeraten, weil der Gewinn im Direktvertrieb höher ist. Und wenn Gustav nur 50 Cent pro Karte im Verkauf nehmen will, können wir den Einzelhandel daran nicht partizipieren lassen. Dale war der Meinung, der Preis sei zu niedrig, und ich wies daraufhin, daß man im Schreibwarengeschäft für eine so aufwendig gedruckte Karte locker 3 Euro zu zahlen hätte.
Während Dale mit der Arbeit an seinem Gedichtband fortfuhr (nächstes Mal müssen wir doch mit dem Drucken anfangen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich all diese Gedichte hinstellen soll) und Freyja ihr Visitenkartengeschäft ausbaute, versuchte sich Annalisa, nachdem sie ebenfalls noch eine Karte gedruckt hatte, in der Kalligrafie mit der Breitfeder, denn ich habe sowohl Federn, Tinte als auch Vorlagen in der Werkstatt, und Annalisa stand der Sinn nach einer kontemplativen Tätigkeit. Ich war angenehm überrascht von den Erstversuchen, zumal ich selbst mit dieser Breitfeder bislang nicht reüssieren konnte.
 Robert druckte eine Visitenkarte für seinen Vater, in die er ein Auto einfügte aus meinem Fundus alter Druckstöcke. Diesen flotten Wagen hatte ich selbst zuvor nicht gedruckt gesehen. Freilich drucke ich das Fahrzeug auf Wunsch auch in die Visitenkarten meiner verehrten Kunden, es ist überaus ziersam. Robert zeichnete noch ein bißchen mit der Spitzfeder und dichtete dann ebenfalls eine Textkarte, die wir allerdings nicht mehr drucken konnten. Allgemein
Robert druckte eine Visitenkarte für seinen Vater, in die er ein Auto einfügte aus meinem Fundus alter Druckstöcke. Diesen flotten Wagen hatte ich selbst zuvor nicht gedruckt gesehen. Freilich drucke ich das Fahrzeug auf Wunsch auch in die Visitenkarten meiner verehrten Kunden, es ist überaus ziersam. Robert zeichnete noch ein bißchen mit der Spitzfeder und dichtete dann ebenfalls eine Textkarte, die wir allerdings nicht mehr drucken konnten. Allgemein  wurde erneut festgestellt, daß die Zeit sehr schnell vorbeigeht. Am Schluß fragte mich Gustav, ob ich mir wohl wünschte, daß seine Ratte nun immer mitkäme in die Druckerey, und ich habe sie herzlich eingeladen, dies zu tun. Wir werden sehen, ob so eine Ratte das in ihrem Terminkalender unterbringen kann. Mir erschien es sehr charmant, mit einem Plüschtier herumzulaufen und ich überlegte, ob es nicht auch manche erwachsenen Leute zugänglicher erscheinen lassen würde. Aber vielleicht warten wir lieber die Durchsetzung des Herrenrockes und der modischen Perücke ab, bevor wir die Attraktivität des Plüschtiers entdecken. Und auch die an Taschen, Autorückspiegel und Schlüsselbunde geknüpften Mini-Teddybären als Prekariats-Symbole müßten erst vollkommen aus der Welt gekommen sein.
wurde erneut festgestellt, daß die Zeit sehr schnell vorbeigeht. Am Schluß fragte mich Gustav, ob ich mir wohl wünschte, daß seine Ratte nun immer mitkäme in die Druckerey, und ich habe sie herzlich eingeladen, dies zu tun. Wir werden sehen, ob so eine Ratte das in ihrem Terminkalender unterbringen kann. Mir erschien es sehr charmant, mit einem Plüschtier herumzulaufen und ich überlegte, ob es nicht auch manche erwachsenen Leute zugänglicher erscheinen lassen würde. Aber vielleicht warten wir lieber die Durchsetzung des Herrenrockes und der modischen Perücke ab, bevor wir die Attraktivität des Plüschtiers entdecken. Und auch die an Taschen, Autorückspiegel und Schlüsselbunde geknüpften Mini-Teddybären als Prekariats-Symbole müßten erst vollkommen aus der Welt gekommen sein.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [2]
Drei Schnitte · 22. Februar 2009
 Mein Vorschlag, eine Postkarten-Edition zu produzieren, wurde von den jungen Druckerey-Schülern nicht aufgenommen. Man könnte vielleicht, man werde sehen. Wir haben enorm produziert, drei Sorten Visitenkarten sowie einen Freundschaftsbeweis, der mir jetzt, wo ich ihn mit Ruhe sehe, seltsam formuliert zu sein scheint. Müßte es nicht heißen “daß ich Dein Freund bin” anstatt “daß Du mein Freund bist”? Oder ist das eine Art Entscheidung im Sinne des Freundes?
Mein Vorschlag, eine Postkarten-Edition zu produzieren, wurde von den jungen Druckerey-Schülern nicht aufgenommen. Man könnte vielleicht, man werde sehen. Wir haben enorm produziert, drei Sorten Visitenkarten sowie einen Freundschaftsbeweis, der mir jetzt, wo ich ihn mit Ruhe sehe, seltsam formuliert zu sein scheint. Müßte es nicht heißen “daß ich Dein Freund bin” anstatt “daß Du mein Freund bist”? Oder ist das eine Art Entscheidung im Sinne des Freundes?
 Erster Schnitt: Ein Künstler hat an seinem Linolschnitt weitergearbeitet, und das Messer ist in ihm in den Daumen gefahren. Erstes Pflaster. Zweiter Schnitt: Der Künstler hat ein weiteres Opfer gebracht, diesmal der Zeigefinger, aber das Werk ist fertig. Zweites Pflaster. Drucken konnten wir das Bild noch nicht. Gleich nächstes Mal.
Erster Schnitt: Ein Künstler hat an seinem Linolschnitt weitergearbeitet, und das Messer ist in ihm in den Daumen gefahren. Erstes Pflaster. Zweiter Schnitt: Der Künstler hat ein weiteres Opfer gebracht, diesmal der Zeigefinger, aber das Werk ist fertig. Zweites Pflaster. Drucken konnten wir das Bild noch nicht. Gleich nächstes Mal.
Dritter Schnitt: der Goldene. Dale hatte nicht vergessen, daß ich letztes Mal von einem Büchlein gesprochen hatte. Da sich bislang niemand beteiligt, schafft er das auch alleine, der Entschluß ist fest. Er hat drei Gedichte gesetzt, die er auswendig kann, weil er sie selbst verfaßt hat. Wir haben auch das Format schon festgelegt, ausgehend von einem  Stapel A5-Bogen, die ich nicht mehr brauche. Daraus wird ein Büchlein in den Proportionen des Goldenen Schnitts. Was hier eine Proportion ist, also das Verhältnis der Seiten zueinander, war leicht zu verstehen, aber wie erkläre ich den Goldenen Schnitt? Maße im Verhältnis 1:1,618 sind mit dem Taschenrechner schnell zu ermitteln. 21:34 mit der Rechenscheibe auch. Und daß es ein irrationales Maßverhältnis ist, das gleichwohl in der Natur gelegentlich vorkommt, etwa im Verhältnis der durchschnittlichen Handlänge zur durchschnittlichen Handbreite, habe ich auch mitgeteilt. Aber ganz aufgeklärt fühlte sich Dale noch nicht. Soll ich ihm mit diesem Lehrsatz kommen?: Zwei Strecken stehen im Verhältnis des Goldenen Schnittes, wenn sich die größere zur kleineren Strecke verhält wie die Summe aus beiden zur größeren. Der Goldene Schnitt verlangte eigentlich eine ganze Unterrichtseinheit. Ich werde einfach noch ein wenig Geschichte einstreuen und schauen, ob ich einen Zirkel finde, um ihn mal auf Papier zu konstruieren. Oder haben meine verehrten Leser guten Rat?
Stapel A5-Bogen, die ich nicht mehr brauche. Daraus wird ein Büchlein in den Proportionen des Goldenen Schnitts. Was hier eine Proportion ist, also das Verhältnis der Seiten zueinander, war leicht zu verstehen, aber wie erkläre ich den Goldenen Schnitt? Maße im Verhältnis 1:1,618 sind mit dem Taschenrechner schnell zu ermitteln. 21:34 mit der Rechenscheibe auch. Und daß es ein irrationales Maßverhältnis ist, das gleichwohl in der Natur gelegentlich vorkommt, etwa im Verhältnis der durchschnittlichen Handlänge zur durchschnittlichen Handbreite, habe ich auch mitgeteilt. Aber ganz aufgeklärt fühlte sich Dale noch nicht. Soll ich ihm mit diesem Lehrsatz kommen?: Zwei Strecken stehen im Verhältnis des Goldenen Schnittes, wenn sich die größere zur kleineren Strecke verhält wie die Summe aus beiden zur größeren. Der Goldene Schnitt verlangte eigentlich eine ganze Unterrichtseinheit. Ich werde einfach noch ein wenig Geschichte einstreuen und schauen, ob ich einen Zirkel finde, um ihn mal auf Papier zu konstruieren. Oder haben meine verehrten Leser guten Rat?
Erstaunlich, wie beliebt Aussagen sind wie “In Deutsch bin ich nicht so gut” oder “Mathe kann ich nicht”, zumal letztes von Freyja, die sehr
 fix und geradezu begeistert ganze ungerade Zahlen dividierte. Man kommt ja ohne ein wenig Kopfrechnen weder an der Druckmaschine aus beim Einrichten der Form noch an der Papierschneidemaschine beim Aufteilen der Bogen in Druckformate. Ich lege es nicht drauf an, Schule zu halten und sage selbst die Lösung, bevor es quälend wird, aber oft können es die Kinder, wohl zumal, wenn das Ergebnis für die Arbeit gebraucht wird. Angewandtes Kopfrechnen zeigt, daß man in der Schule nicht nur sinnlos aufgehalten wird.
fix und geradezu begeistert ganze ungerade Zahlen dividierte. Man kommt ja ohne ein wenig Kopfrechnen weder an der Druckmaschine aus beim Einrichten der Form noch an der Papierschneidemaschine beim Aufteilen der Bogen in Druckformate. Ich lege es nicht drauf an, Schule zu halten und sage selbst die Lösung, bevor es quälend wird, aber oft können es die Kinder, wohl zumal, wenn das Ergebnis für die Arbeit gebraucht wird. Angewandtes Kopfrechnen zeigt, daß man in der Schule nicht nur sinnlos aufgehalten wird.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [2]
Schäumende Tante · 14. Februar 2009
Mir fällt eben noch ein, was ich erzählen wollte, weil es recht lustig ist: Den Kindern zeige ich immer auch, wie man sich die Hände wäscht. Als ich ein Knabe war, habe ich mein Fahrrad mit Elsterglanz geputzt und mir dann die  Hände mit einem hellbraunen Waschsand aus der Tube gewaschen. Dessen Name ist mir entfallen. Den Kindern heute wird offenbar kaum Gelegenheit gegeben, sich die Hände mit kräftigen Waschmitteln waschen zu müssen. Dabei ist Waschsand ja auch amüsant. Den der Marke Grüne Tante verwendete man in der Druckerei Rapputan früher. Und ich war immer enttäuscht, wenn es mal einen Ersatz gab, irgendwelchen weißlichen Schleim etwa. Amüsant ist Grüne Tante, weil er bzw. sie nach Marzipan duftet und so schön grün und sandig und sandig-grün ist. Und die Tante schäumt auch noch.
Hände mit einem hellbraunen Waschsand aus der Tube gewaschen. Dessen Name ist mir entfallen. Den Kindern heute wird offenbar kaum Gelegenheit gegeben, sich die Hände mit kräftigen Waschmitteln waschen zu müssen. Dabei ist Waschsand ja auch amüsant. Den der Marke Grüne Tante verwendete man in der Druckerei Rapputan früher. Und ich war immer enttäuscht, wenn es mal einen Ersatz gab, irgendwelchen weißlichen Schleim etwa. Amüsant ist Grüne Tante, weil er bzw. sie nach Marzipan duftet und so schön grün und sandig und sandig-grün ist. Und die Tante schäumt auch noch.
Ich muß den Kindern immer erst mal zeigen, wie man sich damit wäscht. Das Bildungsschichtenkind nimmt nämlich sonst einen Batzen Waschsand und läßt diesen unter streichelnden Bewegungen unter fließendem Wasser aus den Händen laufen, worauf diese Hände genauso aussehen wie vorher. Druckerschwärze reibt man ja mit dem nur angefeuchteten Sand erst einmal ab. Fast alle mögen Grüne Tante.
 By the way kann ich hier noch die kleine Krone zeigen, die Dale auf seine Visitenkarte gedruckt hat. Sie stand auf der Schließplatte und stach ihm offenbar ins Auge. Ich wollte sie schon lange mal drucken, kannte ihr Bild bislang gar nicht. Und jetzt auf dem Foto sehe ich, daß wir vor den Bindestrich etwas Raum hätten legen müssen, damit er in der Mitte zwischen
By the way kann ich hier noch die kleine Krone zeigen, die Dale auf seine Visitenkarte gedruckt hat. Sie stand auf der Schließplatte und stach ihm offenbar ins Auge. Ich wollte sie schon lange mal drucken, kannte ihr Bild bislang gar nicht. Und jetzt auf dem Foto sehe ich, daß wir vor den Bindestrich etwas Raum hätten legen müssen, damit er in der Mitte zwischen  e und J steht. Bis zur Mikrotypografie sind wir in den ersten Stunden nicht vorgedrungen. Bei dem Krönchen handelt es sich um ein galvanisiertes, also mit Kupfer überzogenes Metall, auf Holz aufgenagelt. Die Bedeutung der Zackenzahl konnte ich meine Schüler nicht lehren. Ich hab mal für einen Prinzen eine fünfzackige Krone gedruckt (glaube ich), und mein Kunde hatte mir auch ein bißchen Aufklärung über die Bedeutung der Zackenanzahl zukommen lassen, aber ich hab es wieder vergessen.
e und J steht. Bis zur Mikrotypografie sind wir in den ersten Stunden nicht vorgedrungen. Bei dem Krönchen handelt es sich um ein galvanisiertes, also mit Kupfer überzogenes Metall, auf Holz aufgenagelt. Die Bedeutung der Zackenzahl konnte ich meine Schüler nicht lehren. Ich hab mal für einen Prinzen eine fünfzackige Krone gedruckt (glaube ich), und mein Kunde hatte mir auch ein bißchen Aufklärung über die Bedeutung der Zackenanzahl zukommen lassen, aber ich hab es wieder vergessen.
 Zuletzt fällt mir noch ein, daß Annalisa zu diesem Bild von Barbara Wrede fragte, ob es einen Unfall an der Schneidemaschine illustriere, über deren Gefahren ich belehrt hatte — obwohl sie in meiner Abwesenheit nicht betätigt werden wird. Aber die Lichtschranken sind schon sehr interessant. Und man spricht dann gern etwas über Unfälle. — Ich hoffe, die Wrede-Zeichnung jagt niemandem Druckerey-Alpträume in den Schlaf. Bei Wrede im Atelier hab ich übrigens auch mal Grüne Tante gesehen.
Zuletzt fällt mir noch ein, daß Annalisa zu diesem Bild von Barbara Wrede fragte, ob es einen Unfall an der Schneidemaschine illustriere, über deren Gefahren ich belehrt hatte — obwohl sie in meiner Abwesenheit nicht betätigt werden wird. Aber die Lichtschranken sind schon sehr interessant. Und man spricht dann gern etwas über Unfälle. — Ich hoffe, die Wrede-Zeichnung jagt niemandem Druckerey-Alpträume in den Schlaf. Bei Wrede im Atelier hab ich übrigens auch mal Grüne Tante gesehen.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [6]
Schräge Halbgevierte in Schülerhänden · 13. Februar 2009
Es hat wieder ein neuer Kurs der Freien Grundschule in meiner Werkstatt begonnen. Fünf Schüler kommen diesmal. Beim ersten Mal haben wir Visitenkarten gesetzt und gedruckt, ohne großen Aufwand, nur um das Handwerk und seine Möglichkeiten ein wenig kennenzulernen. Mir schwebt ja wieder eine Art Büchlein vor. Nächstes Mal werden wir beschließen, wie wir die Termine nutzen.
 Eigentlich haben wir knapp drei Stunden Zeit pro Woche. Und das nach der Schule. Trotzdem konnten sich zwei Buben nur sehr mit Mühe von der Werkstatt trennen. Gustav, der schon einiges über den Bleisatz von Peter Lustig aus dem Fernsehen erfahren hatte, führte seine Mutter und die beiden Brüder, die ihn abholten, so ausführlich durch die Offizin und zeigte die Maschinen, als sei er dafür ausgebildet worden. Und Dale hängte zwanzig Minuten an, um seine Arbeit fertig zu machen.
Eigentlich haben wir knapp drei Stunden Zeit pro Woche. Und das nach der Schule. Trotzdem konnten sich zwei Buben nur sehr mit Mühe von der Werkstatt trennen. Gustav, der schon einiges über den Bleisatz von Peter Lustig aus dem Fernsehen erfahren hatte, führte seine Mutter und die beiden Brüder, die ihn abholten, so ausführlich durch die Offizin und zeigte die Maschinen, als sei er dafür ausgebildet worden. Und Dale hängte zwanzig Minuten an, um seine Arbeit fertig zu machen.
Dale hat mich richtig überrascht, als er mir den Winkelhaken mit seiner zweiten Arbeit zeigte. Er hatte den Namen (in den Fotos wg. Datenschutz teilweise geschwärzt) aus dem Schriftgrad Cicero gesetzt (Schrift: Pracht-Antiqua), dann aber wieder am Petit-Kasten gearbeitet und die Cicero-Zeile gleich dort ausgeschlossen. Als ich den Winkelhaken so sah wie auf dem Foto, war ich erst einmal verdutzt.
Der Knabe hatte mit Petit-Quadraten und Ausschluß ausgeschlossen, dann die Lücke entdeckt und exakt mit Halbgevierten auf Cicero-Stärke die Zeile ergänzt.  Ich mußte lachen, als ich das sah. Und hab rasch meinen Fotoapparat geholt. Dale meinte wohl im ersten Moment, ich wolle mich darüber lustig machen und wehrte ab, aber ich erklärte ihm, daß ich seine Ausschluß-Methode als Erfindung gar nicht hoch genug schätzen könne. Es wirkt erst einmal komisch, wenn der Setzer das sieht, aber dann muß er doch erkennen und anerkennen, daß hier ein Neunjähriger nach drei Stunden ein handwerkliches Prinzip begriffen hat, nämlich das der geschlossenen Druckform, und sich einen Weg gesucht hat, der im Schließrahmen sogar funktionieren könnte. Ich bin begeistert. Geändert habe ich es trotzdem, denn wir arbeiten nach den überlieferten Regeln der Kunst, nicht nach unseren eigenen.
Ich mußte lachen, als ich das sah. Und hab rasch meinen Fotoapparat geholt. Dale meinte wohl im ersten Moment, ich wolle mich darüber lustig machen und wehrte ab, aber ich erklärte ihm, daß ich seine Ausschluß-Methode als Erfindung gar nicht hoch genug schätzen könne. Es wirkt erst einmal komisch, wenn der Setzer das sieht, aber dann muß er doch erkennen und anerkennen, daß hier ein Neunjähriger nach drei Stunden ein handwerkliches Prinzip begriffen hat, nämlich das der geschlossenen Druckform, und sich einen Weg gesucht hat, der im Schließrahmen sogar funktionieren könnte. Ich bin begeistert. Geändert habe ich es trotzdem, denn wir arbeiten nach den überlieferten Regeln der Kunst, nicht nach unseren eigenen.
 Auf diesem Bild sieht man, wie der junge Setzer sich das gedacht hatte. Dies ist einer der Punkte, an dem ich es außerordentlich schätze, mir die jungen Menschen ins Haus geholt zu haben — in der eigenen Werkstatt eine technische Vorführung zu bekommen, passiert ja sonst nicht. Die Ausschlußstücken da so schräg stehen/liegen zu sehen, ist ein freches, ein amüsantes Bild für den Setzer, denn so etwas machen wir nie. Die Satzform ist ein geschlossenes Gebilde, von Rundsatz und dergleichen abgesehen.
Auf diesem Bild sieht man, wie der junge Setzer sich das gedacht hatte. Dies ist einer der Punkte, an dem ich es außerordentlich schätze, mir die jungen Menschen ins Haus geholt zu haben — in der eigenen Werkstatt eine technische Vorführung zu bekommen, passiert ja sonst nicht. Die Ausschlußstücken da so schräg stehen/liegen zu sehen, ist ein freches, ein amüsantes Bild für den Setzer, denn so etwas machen wir nie. Die Satzform ist ein geschlossenes Gebilde, von Rundsatz und dergleichen abgesehen.
Auch sonst war es höchst angenehm, wie die Jugend die Werkstatt entdeckte: erfreut und unternehmungslustig. Wir werden sehen, was dabei herauskommt.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [3]
Lego in Fraktur · 6. November 2008
 In den Berliner Schulferien wurde der Drucker zum Onkel: Nichten und Neffen kamen zu Besuch. Malwina zum Beispiel, die auf dem Foto mit der Presse auf einem Podest steht, weil einem mit 8 Jahren noch ein paar Zentimeter fehlen, hat sich Briefkarten gedruckt mit der Unger-Fraktur, die sie mühelos liest und als schön verschnörkelte Schrift wahrnimmt, nicht als
In den Berliner Schulferien wurde der Drucker zum Onkel: Nichten und Neffen kamen zu Besuch. Malwina zum Beispiel, die auf dem Foto mit der Presse auf einem Podest steht, weil einem mit 8 Jahren noch ein paar Zentimeter fehlen, hat sich Briefkarten gedruckt mit der Unger-Fraktur, die sie mühelos liest und als schön verschnörkelte Schrift wahrnimmt, nicht als  eine absonderliche alte Type. Sie hat mit Redis-, Spitz- und Breitfeder geschrieben, den Cutter ausprobiert (und, von diesem Instrument begeistert, einen Wunsch zum Geburtstag ausgesprochen), Papier geschnitten und am zweiten Tag auch noch Einladungen zum Geburtstag gesetzt, gedruckt und genutet. Eine Druckerei ist eine Schule, Kopfrechnen macht Malwina geradezu Vergnügen.
eine absonderliche alte Type. Sie hat mit Redis-, Spitz- und Breitfeder geschrieben, den Cutter ausprobiert (und, von diesem Instrument begeistert, einen Wunsch zum Geburtstag ausgesprochen), Papier geschnitten und am zweiten Tag auch noch Einladungen zum Geburtstag gesetzt, gedruckt und genutet. Eine Druckerei ist eine Schule, Kopfrechnen macht Malwina geradezu Vergnügen.
 Was eine „coole“ Visitenkarte ist, habe ich von ihrer 13jährigen Schwester Marlene gelernt: ein Totenkopf gehört drauf, ein Stern, eine zeigende Hand, und auf das Aldusblatt, das auf der Karte keinen guten Platz mehr fand, kam sie zurück bei der Produktion von „Denkzetteln“. Mitten im Wort gibt es einen Großbuchstaben, und aus der 6 wird ein b. Erwachsene
Was eine „coole“ Visitenkarte ist, habe ich von ihrer 13jährigen Schwester Marlene gelernt: ein Totenkopf gehört drauf, ein Stern, eine zeigende Hand, und auf das Aldusblatt, das auf der Karte keinen guten Platz mehr fand, kam sie zurück bei der Produktion von „Denkzetteln“. Mitten im Wort gibt es einen Großbuchstaben, und aus der 6 wird ein b. Erwachsene  Design-Studenten brauchen ein paar Stunden länger, um sich von Konventionen freizumachen. Mir selbst ist es ziemlich fremd, und ich habe einiges gelernt. Ob der Totenschädel nun aus der Mode kommt, wo er derzeit ein beliebtes Motiv ist, oder ob ihm natürlicherweise etwas Cooles anhaftet, weiß ich nicht recht. (Die Daten auf den Drucksachen habe ich, wie immer, in der Bildbearbeitung unkenntlich gemacht, eben bis auf die Vornamen.)
Design-Studenten brauchen ein paar Stunden länger, um sich von Konventionen freizumachen. Mir selbst ist es ziemlich fremd, und ich habe einiges gelernt. Ob der Totenschädel nun aus der Mode kommt, wo er derzeit ein beliebtes Motiv ist, oder ob ihm natürlicherweise etwas Cooles anhaftet, weiß ich nicht recht. (Die Daten auf den Drucksachen habe ich, wie immer, in der Bildbearbeitung unkenntlich gemacht, eben bis auf die Vornamen.)
 Julian druckte sich ebenfalls aus Fraktur eine Karte als „Lego-Experte für alle Fälle“, was sicherlich ein schöner Beruf ist. Er verglich die Setzerei mit einer Lego-Anlage, wie so alles zu einer Form gefügt werden kann – und die Anzahl der Teile ist keine geringe. Die Unger-Fraktur ist eine besonders nah an der Antiqua gebildete und gut lesbare Schrift,
Julian druckte sich ebenfalls aus Fraktur eine Karte als „Lego-Experte für alle Fälle“, was sicherlich ein schöner Beruf ist. Er verglich die Setzerei mit einer Lego-Anlage, wie so alles zu einer Form gefügt werden kann – und die Anzahl der Teile ist keine geringe. Die Unger-Fraktur ist eine besonders nah an der Antiqua gebildete und gut lesbare Schrift,  aber es hat mich trotzdem gefreut, daß sich gleich zwei Kinder diese Schrift ausgesucht haben. Ihr kalligrafischer Reiz ist eben schwer zu überbieten. Die Englische Schreibschrift hatte ich nicht angeboten, sie ist zu empfindlich und zu schwer zu setzen für Anfänger. Auf die Schreib- und Zierschriften habe ich nicht besonders hingewiesen. Angeboten hatte ich Garamond in gerade und kursiv, Futura und eben die Unger-Fraktur.
aber es hat mich trotzdem gefreut, daß sich gleich zwei Kinder diese Schrift ausgesucht haben. Ihr kalligrafischer Reiz ist eben schwer zu überbieten. Die Englische Schreibschrift hatte ich nicht angeboten, sie ist zu empfindlich und zu schwer zu setzen für Anfänger. Auf die Schreib- und Zierschriften habe ich nicht besonders hingewiesen. Angeboten hatte ich Garamond in gerade und kursiv, Futura und eben die Unger-Fraktur.
 Großen Reiz strahlt der Fundus von Druckstöcken aus. Julian hat sich den schlangenhaften Aal für seine Karte ausgesucht, einen mit Kupfer galvanisierten Metalldruckstock auf einem Holzfuß.
Großen Reiz strahlt der Fundus von Druckstöcken aus. Julian hat sich den schlangenhaften Aal für seine Karte ausgesucht, einen mit Kupfer galvanisierten Metalldruckstock auf einem Holzfuß.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [9]
Ein Werpudel · 23. Juni 2008
 Am Freitag hatte ich wieder erfreulichen Besuch der vier Druckerlehrlinge aus der Freien Grundschule. Der große Pedal-Boston begeistert sie jedes Mal. Robert war hingerissen, als er die laufende Presse von hinten sah, wo die Mechanik mit Wellen und Zahnrädern offenliegt. Ich bin freilich immer in routinierter Sorge: Solange keine Druckform in der Maschine hängt, kann man sich die Finger nicht einquetschen. Außerdem müßten sich die jungen Leute wegen der Kürze ihrer Arme enorm anstrengen, einen derartigen Unfall herbeizuführen. Ich wache trotzdem mit Argusaugen und erinnere gelegentlich an die Regeln über das Bewegen in einer Druckerei. Kinder können sehr schnell sein.
Am Freitag hatte ich wieder erfreulichen Besuch der vier Druckerlehrlinge aus der Freien Grundschule. Der große Pedal-Boston begeistert sie jedes Mal. Robert war hingerissen, als er die laufende Presse von hinten sah, wo die Mechanik mit Wellen und Zahnrädern offenliegt. Ich bin freilich immer in routinierter Sorge: Solange keine Druckform in der Maschine hängt, kann man sich die Finger nicht einquetschen. Außerdem müßten sich die jungen Leute wegen der Kürze ihrer Arme enorm anstrengen, einen derartigen Unfall herbeizuführen. Ich wache trotzdem mit Argusaugen und erinnere gelegentlich an die Regeln über das Bewegen in einer Druckerei. Kinder können sehr schnell sein.
 Wir haben am Freitag den zweiten Druckgang für unser Büchlein erledigt, Stella hat Briefmarken perforiert mit der im vorhergehenden Beitrag gezeigten Rillmaschine, die man auch umwandeln kann in eine Perforiermaschine, Moritz hat Papier geschnitten, Jonas den ersten Abzug seiner Briefmarke gedruckt, und gedruckt haben alle. Da wir vierzig Exemplare machen, druckt jeder zehn.
Wir haben am Freitag den zweiten Druckgang für unser Büchlein erledigt, Stella hat Briefmarken perforiert mit der im vorhergehenden Beitrag gezeigten Rillmaschine, die man auch umwandeln kann in eine Perforiermaschine, Moritz hat Papier geschnitten, Jonas den ersten Abzug seiner Briefmarke gedruckt, und gedruckt haben alle. Da wir vierzig Exemplare machen, druckt jeder zehn.
Passiert ist trotz meiner Sicherheitshinweise etwas. Aber erst als die Kinder weg waren. Da hab ich nämlich Lust bekommen auf  einen Linolschnitt und ist mir prompt ein Messer in den Finger geglitten. Aber nicht schlimm, nicht mal ein Pflaster war nötig. Und typisch. Man belehrt die anderen, und sobald man alleine ist, passiert Unsinn. Ich hab überlegt, wie ein Werwolf aussieht, aber martialisch zu zeichnen, hatte ich keine Lust. Wenn sich zahme Menschen verwandeln, dann vielleicht auch in einen Werpudel. Insofern ist das möglicherweise ein Selbstporträt. Die Krone des Wauwaus habe ich noch etwas gekürzt. Mal sehen, ob die Lehrlinge bereit sind, ihn in unser Büchlein aufzunehmen.
einen Linolschnitt und ist mir prompt ein Messer in den Finger geglitten. Aber nicht schlimm, nicht mal ein Pflaster war nötig. Und typisch. Man belehrt die anderen, und sobald man alleine ist, passiert Unsinn. Ich hab überlegt, wie ein Werwolf aussieht, aber martialisch zu zeichnen, hatte ich keine Lust. Wenn sich zahme Menschen verwandeln, dann vielleicht auch in einen Werpudel. Insofern ist das möglicherweise ein Selbstporträt. Die Krone des Wauwaus habe ich noch etwas gekürzt. Mal sehen, ob die Lehrlinge bereit sind, ihn in unser Büchlein aufzunehmen.
Die Schneidemaschine erfreut sich ebenso großer Beliebtheit wie der große Drucktiegel. Hier bleibe ich allerdings immer daneben stehen. Die Maschine ist zwar sicher durch Lichtschranke und erzwungene Zweihandbedienung, aber die Programmierung zu unterrichten, wäre zu langwierig, ist auch nicht Kern der Unterrichtung, man kann  Fehler machen, es kann etwas anderes als Papier unters Messer kommen, ein Lineal beispielsweise, und das würde mindestens das Messer killen, wenn nicht sogar einen Sicherheitsbolzen in der Schneideanlage, den ich nicht alleine auswechseln kann. Und das Messer ist scharf wie eine Rasierklinge. Junge Menschen vergessen manchmal Warnungen, also bleibe ich immer dabei. Auf dem Foto ist Moritz zu sehen, der seine Briefmarken schneidet, und Robert freut sich schon auf nächsten Freitag, wenn er schneiden wird. Einen Schnittrest des selbstklebenden Papiers hat er sich heute als Bauchbinde beschriftet, denn es gab in der Schule eine Ausstellungseröffnung. Tolle Idee, die lebende Litfaßsäule.
Fehler machen, es kann etwas anderes als Papier unters Messer kommen, ein Lineal beispielsweise, und das würde mindestens das Messer killen, wenn nicht sogar einen Sicherheitsbolzen in der Schneideanlage, den ich nicht alleine auswechseln kann. Und das Messer ist scharf wie eine Rasierklinge. Junge Menschen vergessen manchmal Warnungen, also bleibe ich immer dabei. Auf dem Foto ist Moritz zu sehen, der seine Briefmarken schneidet, und Robert freut sich schon auf nächsten Freitag, wenn er schneiden wird. Einen Schnittrest des selbstklebenden Papiers hat er sich heute als Bauchbinde beschriftet, denn es gab in der Schule eine Ausstellungseröffnung. Tolle Idee, die lebende Litfaßsäule.
Moritz trug ein T-Shirt mit Aufdruck in Fraktur, ich sehe das jetzt erst auf den Fotos. Nächstes Mal muß ich den Gästen etwas von den Schriften erzählen!
— Martin Z. Schröder
Sondermarken drucken · 19. Juni 2008
 Derzeit ist viel zu tun, ich komme kaum nach mit den Berichten. Meine vier jungen Freitagsgäste kamen vergangenen Freitag auf die Idee, Briefmarken zu drucken. Dazu habe ich den Fundus alter Druckstöcke geöffnet, hunderte kleine Holzstiche und Metallklischees aus Blei, Messing und Kupfer. Stella möchte eine Sondermarke
Derzeit ist viel zu tun, ich komme kaum nach mit den Berichten. Meine vier jungen Freitagsgäste kamen vergangenen Freitag auf die Idee, Briefmarken zu drucken. Dazu habe ich den Fundus alter Druckstöcke geöffnet, hunderte kleine Holzstiche und Metallklischees aus Blei, Messing und Kupfer. Stella möchte eine Sondermarke für ihren Vater anfertigen, sie hat aus der Schrift Figaro, die sie in Lucky-Luke-Schrift umbenannte, den Vornamen des Vaters gesetzt und sich dazu für ein Motorrad aus Holz entschieden. Wie filigran dieser Stich gearbeitet ist! Solche Stiche hat man vorgeätzt, ich werde bei Gelegenheit noch einmal in meine Bücher schauen, ob ich eine Beschreibung des Vorganges finde.
für ihren Vater anfertigen, sie hat aus der Schrift Figaro, die sie in Lucky-Luke-Schrift umbenannte, den Vornamen des Vaters gesetzt und sich dazu für ein Motorrad aus Holz entschieden. Wie filigran dieser Stich gearbeitet ist! Solche Stiche hat man vorgeätzt, ich werde bei Gelegenheit noch einmal in meine Bücher schauen, ob ich eine Beschreibung des Vorganges finde.
 Stella hat berechnet, welche Menge an Etiketten sie aus einem Rohbogen schneiden kann und dann an der computergesteuerten Schneidemaschine zugeschnitten. Die Formel dafür hat sie sofort aus dem Hut gezaubert. Die große Schneidemaschine ist durch Lichtschranke und den Zwang zur beidhändigen Auslösung der Schneidvorganges sehr sicher,
Stella hat berechnet, welche Menge an Etiketten sie aus einem Rohbogen schneiden kann und dann an der computergesteuerten Schneidemaschine zugeschnitten. Die Formel dafür hat sie sofort aus dem Hut gezaubert. Die große Schneidemaschine ist durch Lichtschranke und den Zwang zur beidhändigen Auslösung der Schneidvorganges sehr sicher,  trotzdem bleibe ich beim Schneiden immer dabei. Mit dem Morgenstern-Werwolf-Büchlein müssen wir morgen aber voran kommen, bis zu den Ferien sind es nur noch vier Termine.
trotzdem bleibe ich beim Schneiden immer dabei. Mit dem Morgenstern-Werwolf-Büchlein müssen wir morgen aber voran kommen, bis zu den Ferien sind es nur noch vier Termine.
— Martin Z. Schröder
Nachtrag vom letzten Freitag: Junge Gäste · 13. Juni 2008
 Heute werde ich wieder meine vier Gäste abholen, mit denen ich das Morgenstern-Gedicht vom Werwolf in Minibuchform (Englische Broschur) bringe. Da der Text aus einer Schrift gesetzt wird, teilten sich drei (hier von links nach rechts Jonas, Stella und Moritz) am vergangenen Freitag einen großen Werkschriftkasten, in dem
Heute werde ich wieder meine vier Gäste abholen, mit denen ich das Morgenstern-Gedicht vom Werwolf in Minibuchform (Englische Broschur) bringe. Da der Text aus einer Schrift gesetzt wird, teilten sich drei (hier von links nach rechts Jonas, Stella und Moritz) am vergangenen Freitag einen großen Werkschriftkasten, in dem  die Garamond in Cicero (12 Punkt) liegt. Zwei Druckbogen à vier Seiten werden produziert, das Gedicht hat aber gar nicht so viele Strophen. Also gibt es noch Platz für Illustrationen. Robert (auf dem Foto am Boston-Tiegel) hat mit einem Schnitt angefangen, der den offenen Sarg des Schulmeisters zeigt, der ja aus dem Grabe gestiegen, um den Werwolf zu beugen in Werwolf, Wenwolf, Wemwolf … Es ist
die Garamond in Cicero (12 Punkt) liegt. Zwei Druckbogen à vier Seiten werden produziert, das Gedicht hat aber gar nicht so viele Strophen. Also gibt es noch Platz für Illustrationen. Robert (auf dem Foto am Boston-Tiegel) hat mit einem Schnitt angefangen, der den offenen Sarg des Schulmeisters zeigt, der ja aus dem Grabe gestiegen, um den Werwolf zu beugen in Werwolf, Wenwolf, Wemwolf … Es ist  Roberts erster Linolschnitt. Stella kennt diese Technik schon aus dem Schulunterricht und hat sehr sorgfältig die Details geschnitten. Anderthalb Stunden pro Woche sind für einen Druckereilehrgang zu kurz, das habe ich schon festgestellt. Selbst wenn man nur einen Termin pro Woche macht, unter drei Stunden braucht man kaum anzufangen,
Roberts erster Linolschnitt. Stella kennt diese Technik schon aus dem Schulunterricht und hat sehr sorgfältig die Details geschnitten. Anderthalb Stunden pro Woche sind für einen Druckereilehrgang zu kurz, das habe ich schon festgestellt. Selbst wenn man nur einen Termin pro Woche macht, unter drei Stunden braucht man kaum anzufangen,  zumal nachmittags, wenn alle schon etwas müde sind und immer mal eine Pause brauchen. Das Setzen oder auch der Linolschnitt sind keine ganz leichten Arbeiten. Ich habe Lust bekommen, auch mal wieder einen Linolschnitt zu machen. Da letzten Freitag keiner einen Werwolf schneiden wollte, versuche ich es vielleicht. Als Stadtbewohner bin ich nicht gut in Pferden und Rindern, Hunde und Katzen kann ich halbwegs.
zumal nachmittags, wenn alle schon etwas müde sind und immer mal eine Pause brauchen. Das Setzen oder auch der Linolschnitt sind keine ganz leichten Arbeiten. Ich habe Lust bekommen, auch mal wieder einen Linolschnitt zu machen. Da letzten Freitag keiner einen Werwolf schneiden wollte, versuche ich es vielleicht. Als Stadtbewohner bin ich nicht gut in Pferden und Rindern, Hunde und Katzen kann ich halbwegs. Mal sehen. Ich werde berichten. Das letzte Foto hier zeigt keinen echten Druck aus der Maschine, sondern nur einen Kontrollabzug, nur mit dem Handballen gemacht, damit man mal was sieht.
Mal sehen. Ich werde berichten. Das letzte Foto hier zeigt keinen echten Druck aus der Maschine, sondern nur einen Kontrollabzug, nur mit dem Handballen gemacht, damit man mal was sieht.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [3]
Kids & Quiz (und ein grammatikrünstiger Werwolf) · 31. Mai 2008
Drei Themen serviere ich heute, und deshalb jedes möglichst knapp.
Erstens Am Freitag hatte ich den zweiten Besuch der Kinder aus der Freien Grundschule ein paar Straßen weiter. Von den vier gebuchten kamen diesmal drei, einer war leider krank. Gute Besserung, Robert!
Stella hat sich so geschickt angestellt, daß ich meine, sie könne gleich als Lehrling einsteigen. Ich war beeindruckt, was sie sich alles gemerkt hat von letzter Woche. Junge Leute sind schneller im Setzkasten zu Hause als ältere, das Gehirn ist noch weniger ausgelastet und hungert nach Informationszufuhr.
 Moritz und Jonas haben einstiegsweise eine Visitenkarte gesetzt und gedruckt, wie Stella und Robert letzte Woche, um den Setzkasten und die Handhabung des Winkelhakens kennenzulernen. An den Fächern stehen die Buchstaben ja nicht dran, der Kasten ist so aufgeteilt, daß der rechten Hand des Setzers die Buchstaben nahe liegen, die er oft benötigt und jene entfernter, die er selten braucht. Also direkt rechts unten liegt die Minuskel e, der in der deutschen Sprache am häufigsten benutzte Buchstabe, darüber gleich das n, die Buchstaben mit Akzent indes am weitesten entfernt: ganz links. Also müssen Anfänger den Buchstaben erst auf einem Setzkastenschema suchen, das neben dem Kasten liegt, und dann das originale Fach. Anfangs helfe ich dabei und zeige die Fächer, denn der Kasten hat 125 davon, und bis man dann ein h gefunden hat … Meine Gäste helfen sich allerdings auch gegenseitig, es geht höchst kollegial zu.
Moritz und Jonas haben einstiegsweise eine Visitenkarte gesetzt und gedruckt, wie Stella und Robert letzte Woche, um den Setzkasten und die Handhabung des Winkelhakens kennenzulernen. An den Fächern stehen die Buchstaben ja nicht dran, der Kasten ist so aufgeteilt, daß der rechten Hand des Setzers die Buchstaben nahe liegen, die er oft benötigt und jene entfernter, die er selten braucht. Also direkt rechts unten liegt die Minuskel e, der in der deutschen Sprache am häufigsten benutzte Buchstabe, darüber gleich das n, die Buchstaben mit Akzent indes am weitesten entfernt: ganz links. Also müssen Anfänger den Buchstaben erst auf einem Setzkastenschema suchen, das neben dem Kasten liegt, und dann das originale Fach. Anfangs helfe ich dabei und zeige die Fächer, denn der Kasten hat 125 davon, und bis man dann ein h gefunden hat … Meine Gäste helfen sich allerdings auch gegenseitig, es geht höchst kollegial zu.
Wir haben immer nur anderthalb Stunden Zeit und insgesamt nur sieben Termine, weshalb ich also die Arbeit vorher plane und meinen Gästen vorschlage. Vorgeschlagen habe ich, das Grammatik-Gedicht „Der Werwolf“ von Christian Morgenstern auf die Seiten eines achtseitigen Büchleins zu verteilen. Dem wurde zugestimmt. Auf meine Frage, die ich eher mir selbst als den jungen Druckern stellte, welche Schrift wir nehmen sollten, wünschte sich Stella sofort die „Lucky-Luke-Schrift“, womit sie die Figaro meinte. Aber die ist zu groß für den Text. Ich habe mich für die Garamond als Buch-Klassiker entschieden. Aller Anfang sollte von der Klassik ausgehen.
Ich habe den Kindern das Gedicht deklamiert und wurde vor die Frage gestellt, was denn die Fälle wären. Die dritte Strophe des Gedichtes lautet:
»Der Werwolf« – sprach der gute Mann,
»des Weswolfs, Genitiv sodann,
dem Wemwolf, Dativ, wie man’s nennt,
den Wenwolf, – damit hat’s ein End.«
Hui, ich hatte mich ein wenig darauf eingestellt, den Unterschied zwischen den Fällen zu erklären, aber die Hauptfrage konnte ich nur mit einer sehr unzulänglichen Erklärung beantworten: sprachliche Konstruktion. Kann mir bitte jemand helfen und eine Erklärung geben, was denn die Fälle an sich sind?
 Gegen Fotos und Veröffentlichung hier hatten die Kinder keine Einwände, aber ich muß doch auch die Eltern fragen und hab deren Kindern ein Brieflein mit der Bitte um Erlaubnis mitgegeben, weshalb es hier nur diese Ansichten gibt. Die von mir verwackelte Handaufnahme zeigt, wieviel Text Stella schon im Winkelhaken hat, die komplette erste Strophe. Für Moritz und Jonas (Bild oben) war es heute noch ein ziemliches Suchspiel.
Gegen Fotos und Veröffentlichung hier hatten die Kinder keine Einwände, aber ich muß doch auch die Eltern fragen und hab deren Kindern ein Brieflein mit der Bitte um Erlaubnis mitgegeben, weshalb es hier nur diese Ansichten gibt. Die von mir verwackelte Handaufnahme zeigt, wieviel Text Stella schon im Winkelhaken hat, die komplette erste Strophe. Für Moritz und Jonas (Bild oben) war es heute noch ein ziemliches Suchspiel.
Was mich in beste Stimmung versetzt, ist jugendlich unartige Schlagfertigkeit. In einer Werkstatt wie meiner muß ich freilich gegenüber Anfängern (auch älteren) Warnungen ausstoßen vor allerley Gefahren, auch vor dem Blei, das giftig wirkt, wenn man es zu sich nimmt, weshalb man mit ungewaschenen Händen nicht speisen dürfe. “Auch nicht popeln?” kam es prompt zurück.
 Zweitens Ich durfte eine Einladung zu einem Rittermahl auf einer Burg in Fraktur drucken, das kommt so selten vor, daß ich vor Freude beinahe hopse, wenn mich so ein Wunsch erreicht. Ausgeführt ist diese Akzidenz im Altarfalz, einer sehr feinen Form der Einladung: Man öffnet sie wie die Pforten zu einem breiten Foyer. Damit der Druck auf der Außenseite nach innen durchscheint, verwende ich dafür ein nur 160 g/m² starkes Feinpapier, keinen Karton.
Zweitens Ich durfte eine Einladung zu einem Rittermahl auf einer Burg in Fraktur drucken, das kommt so selten vor, daß ich vor Freude beinahe hopse, wenn mich so ein Wunsch erreicht. Ausgeführt ist diese Akzidenz im Altarfalz, einer sehr feinen Form der Einladung: Man öffnet sie wie die Pforten zu einem breiten Foyer. Damit der Druck auf der Außenseite nach innen durchscheint, verwende ich dafür ein nur 160 g/m² starkes Feinpapier, keinen Karton.
 Drittens Die Danksagung dazu stellte mich vor ein Problem. Gewünscht wurde ein großes Danke in Fraktur mit einem Schmuck, wie er hier zu sehen ist. Aber die Unger-Fraktur, aus der die oben gezeigte Einladung gesetzt ist, habe ich nicht in einem so großen Schriftgrad. Ich mußte also ausweichen. Einerseits ist es eine schöne Drucksache, was ich dann mit der
Drittens Die Danksagung dazu stellte mich vor ein Problem. Gewünscht wurde ein großes Danke in Fraktur mit einem Schmuck, wie er hier zu sehen ist. Aber die Unger-Fraktur, aus der die oben gezeigte Einladung gesetzt ist, habe ich nicht in einem so großen Schriftgrad. Ich mußte also ausweichen. Einerseits ist es eine schöne Drucksache, was ich dann mit der  Zentenar-Fraktur verwirklichte, andererseits doch ein Fehler. Dieses Blog wurde einmal mit einem kostenlosen Fernstudium verglichen, und das Zwiebelfisch-Quiz hatte ja schönen Anklang gefunden. Nun eine neue Frage: Warum passen diese Schrift und dieses Ornament um Himmels Willen nicht zusammen? Dafür gibt es zwar keine Preis-Sendung, aber breite Anerkennung.
Zentenar-Fraktur verwirklichte, andererseits doch ein Fehler. Dieses Blog wurde einmal mit einem kostenlosen Fernstudium verglichen, und das Zwiebelfisch-Quiz hatte ja schönen Anklang gefunden. Nun eine neue Frage: Warum passen diese Schrift und dieses Ornament um Himmels Willen nicht zusammen? Dafür gibt es zwar keine Preis-Sendung, aber breite Anerkennung.
Schlußbemerkung: Am heutigen Sonnabend erscheint in der Wochenendbeilage der Süddeutschen Zeitung auf der Literaturseite ein Bericht von mir über meine Begegnungen mit den heimlichen Genossen des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR vor zwanzig Jahren. Wenn hier eines Tages mal wieder Geschichtenzeit ist, reiche ich den Text auch im Blog nach.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [8]
Arbeit: Spiel oder Fron? · 25. Mai 2008
 In der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt Jörg-Olaf Schäfers in seinem Notizblog sehr nett über die Druckerey und dieses Blog, dessen Berichterstattung von meiner Arbeit ihn an jene Druckerei erinnerte, der er als Schüler die digitale Anfertigung seiner Spickzettel anvertraute und deren Maschinenpark ihn faszinierte.
In der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt Jörg-Olaf Schäfers in seinem Notizblog sehr nett über die Druckerey und dieses Blog, dessen Berichterstattung von meiner Arbeit ihn an jene Druckerei erinnerte, der er als Schüler die digitale Anfertigung seiner Spickzettel anvertraute und deren Maschinenpark ihn faszinierte.
Am Freitag hat eine Zusammenarbeit mit einer in der Nähe befindlichen Freien Grundschule begonnen. Jeden Freitag bis zu den Sommerferien werden nun vier 11- und 12jährige in meine Werkstatt kommen. “Das ist jetzt mein Lieblingskurs” wurde nach der ersten Stunde ausgerufen. Es ist ein angenehmes Gefühl, wenn einem gesagt wird, daß man einen unterhaltsamen Beruf ausübt. Beinahe bekommt man ein schlechtes Gewissen, weil Arbeit oft einen unangenehmen Beigeschmack hat: wenn man sich nicht aussuchen kann, was man tut, wenn die Arbeit stupide und langweilig ist, wenn sie einen nicht interessiert, wenn man keinen Sinn in ihr sieht, wenn sie zu anstrengend ist. Leider gibt es noch viel zu viele solcher Arbeitsplätze und wird zu wenig Verantwortung an den Arbeiter übertragen. Oft liegt es aber auch an der eigenen Sicht auf die Arbeit: schickt man sich in die Notwendigkeit, den eigenen Unterhalt zu verdienen und versucht mit philosophischer Heiterkeit, mehr daraus zu gewinnen oder erduldet man die Arbeit nur? Da ich zu Ausgeglichenheit und guter Laune neige, habe ich (meistens mit Erfolg) immer versucht, mir auch doofe Arbeit schmackhaft zu machen, bis ich eine Tätigkeit gefunden hatte, die ich wirklich ausüben wollte. Wenn man Arbeit vergibt, sollte man darauf achten, daß Angestellte Freude daran gewinnen, nicht ihre Lebenszeit verschleudern. Außerdem steigert Freude am Tun die Leistung, das lohnt sich für alle.
Am Freitag konnte ich schon schnell Verantwortung übergeben, denn die Kinder stellten sich sehr geschickt an. Stella hat nach einer Stunde ihre erste Druckform geschlossen und in die Maschine gehoben, das Setzen machte ihr aber mehr Spaß, vielleicht, weil es auch noch ein Suchspiel im Setzkasten ist. Robert hätte wohl am liebsten am Pedaltiegel gearbeitet, der ihn wegen des großen Rades und des dumpfen Ratterns an eine Lokomotive erinnerte. Aber der muß für die Kinder leider tabu bleiben, weil er zu viele Gefahren birgt. Ich hätte Angst vor Unfällen. An solchen Maschinen dürfen nur deren Besitzer arbeiten; das ist gesetzlich geregelt, was mir vernünftig erscheint.
Ich werde mit den Kindern und deren Eltern besprechen, ob ich hier Fotos von unserer Arbeit zeigen darf; bis zu den Ferien würde ich natürlich gern nicht weniger herstellen als, natürlich: ein Büchlein.
— Martin Z. Schröder
Führerscheine drucken · 3. Januar 2008
Heute waren die beiden Jungen aus der Nachbarschaft in der Werkstatt. Kaum hatten sie mich gestern, am ersten Arbeitstag nach den Ferientagen entdeckt, kamen sie herein: „Können wir jetzt?“ Aber ich war gerade dabei, die Gletscherlandschaft auf meinem Schreibtisch abzuschmelzen. Heute nahm ich mir zwei Stunden Zeit. Kinder auf die Zukunft zu vertrösten – das schmeckt immer etwas schal.
Ursprünglich wollten sie Visitenkarten drucken, weil das eine meiner Hauptbeschäftigungen ist. Aber eine Druckerei kann ja mehr. Ich schlug ihnen Geheimdienstausweise vor, was sie erheiterte, und Führerscheine, was ihnen höchst geeignet erschien.
Die beiden sind zehn und elf Jahre alt (und nicht acht, wie ich irrig geschätzt hatte) und gehen in die Grundschule eine Straße weiter. Einer der beiden wurde dorthin strafversetzt. Das Strafrechtssystem der Pädagogik wirkt auf mich befremdlich: Der Knabe wurde beschuldigt, eine Sache verunstaltet zu haben; soviel ich verstanden habe, war ein gewisser Sachschaden entstanden und eine gewisse Peinlichkeit. Er sei es nicht gewesen, berichtete er mir, er habe aber zugeschaut. Da er früher manchmal die Unwahrheit gesagt habe, habe man ihm nun nicht geglaubt und ihn für schuldig erklärt. An der neuen Schule gefalle es ihm nun besser. Ist es das, was man ausgleichende Gerechtigkeit nennt? Das Schicksal waltete gütig. Ist aber die Vorstellung, man könne Probleme lösen, indem man vermeintliche oder wirkliche Verursacher aus einer Gemeinschaft entfernt, mit unserer Kultur, unseren Wertvorstellungen vereinbar? Hier handelten Pädagogen wie Strafrichter, allerdings ohne die Grundsätze unserer Rechtsordnung einzuhalten: bewiesener Sachverhalt, definierter Tatbestand, Würdigung der Umstände, Mitspracherecht, gesetzliche Rechtsfolge. Ich wünsche jedem Kind, das in der Schule dermaßen dumm und gemein behandelt wird, daß es genug Leute kennt, die sein Gerechtigkeitsgefühl im Lot halten. Schule zeigt sich nicht selten als Parallelgesellschaft, fern unserer Rechtsordnung.
 Den Führerschein haben wir aus lichter Futura (das Versal D), Futura Buch (Titel), Schreibmaschinenschrift (Ort, Datum) und magerer Futura (Gültigkeitshinweis) gesetzt. Einer der beiden zeigt mir in einer schnellen Skizze die Serifen an einem E und erklärte, daß eine solche Schrift auf meinem Führerschein, den ich gezückt hatte, keine Verwendung gefunden habe und daher auch für ihren nicht eingesetzt werden solle. Die Namen haben wir in Schreibmaschinenschrift-Versalien gesetzt, auf den Fotos sind Druck und Bleisatz der
Den Führerschein haben wir aus lichter Futura (das Versal D), Futura Buch (Titel), Schreibmaschinenschrift (Ort, Datum) und magerer Futura (Gültigkeitshinweis) gesetzt. Einer der beiden zeigt mir in einer schnellen Skizze die Serifen an einem E und erklärte, daß eine solche Schrift auf meinem Führerschein, den ich gezückt hatte, keine Verwendung gefunden habe und daher auch für ihren nicht eingesetzt werden solle. Die Namen haben wir in Schreibmaschinenschrift-Versalien gesetzt, auf den Fotos sind Druck und Bleisatz der  Blanko-Ausweise zu sehen, die wir noch zusätzlich gedruckt haben. So gründet man eine Führerscheinbehörde. Für eine andere Drucksache hatte ich ein Olivgrün gemischt aus lasierendem Oliv, Drucköl, Gelb, Hellbraun und gelblichem Grün. Das mußte dann auch für die Karten genügen; der Karton dazu kommt aus dem Restebestand: Pop’Set Five Cyber Grey 250g/m² von Arjowiggins.
Blanko-Ausweise zu sehen, die wir noch zusätzlich gedruckt haben. So gründet man eine Führerscheinbehörde. Für eine andere Drucksache hatte ich ein Olivgrün gemischt aus lasierendem Oliv, Drucköl, Gelb, Hellbraun und gelblichem Grün. Das mußte dann auch für die Karten genügen; der Karton dazu kommt aus dem Restebestand: Pop’Set Five Cyber Grey 250g/m² von Arjowiggins.
 In den zwei Stunden haben wir gesetzt, Papier geschnitten und gedruckt, wurden die Führerscheine von ihren Eigentümern unterschrieben und waren meine Besucher einmal auf dem Hof und einmal auf der Straße, weil sie Bewegung brauchten. Hinterher boten sie mir, weil ihnen die Arbeit soviel Spaß gemacht hatte, einen Ausbildungsvertrag an, fanden die von mir grob veranschlagten Kosten für zwei Jahre aber deutlich zu hoch, um sie ihren Eltern zumuten zu können. Worauf ich vorschlug, erst einmal die Schullaufbahn weiter zu verfolgen und die Verhandlungen in einigen Jahren erneut aufzunehmen. Sie sagten mir, daß sie es nett von mir fänden, daß ich mir die Zeit genommen hatte, ich überließ ihnen noch zwei aufwendige Papiermusterhefte, sie dankten für alles, verabschiedeten sich und gingen, und ich nehme an, sie werden künftig wieder mal hereinschauen. Daß wir eigentlich zwei Unterrichtsstunden abgehalten haben, daß sie ein bißchen rechneten, etwas über Schrift erfuhren, Einblick in die Preiskalkulation nahmen, also einen Beruf in groben Zügen kennenlernten, haben sie vermutlich nicht als „Beschulung“ erfahren. Ich auch nicht, denn ich habe mich nicht vorbereiten müssen und keinen Plan verfolgt. Und ich habe ein wenig über das heutige Kinderleben in meinem Kiez gelernt. Es waren zwei vergnügliche Stunden.
In den zwei Stunden haben wir gesetzt, Papier geschnitten und gedruckt, wurden die Führerscheine von ihren Eigentümern unterschrieben und waren meine Besucher einmal auf dem Hof und einmal auf der Straße, weil sie Bewegung brauchten. Hinterher boten sie mir, weil ihnen die Arbeit soviel Spaß gemacht hatte, einen Ausbildungsvertrag an, fanden die von mir grob veranschlagten Kosten für zwei Jahre aber deutlich zu hoch, um sie ihren Eltern zumuten zu können. Worauf ich vorschlug, erst einmal die Schullaufbahn weiter zu verfolgen und die Verhandlungen in einigen Jahren erneut aufzunehmen. Sie sagten mir, daß sie es nett von mir fänden, daß ich mir die Zeit genommen hatte, ich überließ ihnen noch zwei aufwendige Papiermusterhefte, sie dankten für alles, verabschiedeten sich und gingen, und ich nehme an, sie werden künftig wieder mal hereinschauen. Daß wir eigentlich zwei Unterrichtsstunden abgehalten haben, daß sie ein bißchen rechneten, etwas über Schrift erfuhren, Einblick in die Preiskalkulation nahmen, also einen Beruf in groben Zügen kennenlernten, haben sie vermutlich nicht als „Beschulung“ erfahren. Ich auch nicht, denn ich habe mich nicht vorbereiten müssen und keinen Plan verfolgt. Und ich habe ein wenig über das heutige Kinderleben in meinem Kiez gelernt. Es waren zwei vergnügliche Stunden.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [2]
Junge Setzer und Drucker, Teil 2 · 7. Dezember 2007
Im Dezember vergangenen Jahres bot ich Freunden an, einen ihrer Söhne für ein paar Tage in meine Werkstatt zu entsenden zu einem Bildungsurlaub. Die Freunde kamen  auf den Gedanken, daß es mit zwei Buben für alle Beteiligten angenehmer sein könnte; aus Erfahrung befürwortete ich diesen Vorschlag, und im August wurden mir für eine Woche zwei 8jährige Praktikanten ins Haus gebracht: Malte (links im Bild) und Luca (in der Mitte). Die Vorbereitung dieser Aktion war recht ungefähr, weil ich einen der beiden nicht sehr gut, den anderen gar nicht kannte. Aber ich wollte schon wie einst mein erster Meister (siehe Teil 1) ein Werk fabrizieren, das wir alle drei auch noch Jahre später gern in den Händen halten würden.
auf den Gedanken, daß es mit zwei Buben für alle Beteiligten angenehmer sein könnte; aus Erfahrung befürwortete ich diesen Vorschlag, und im August wurden mir für eine Woche zwei 8jährige Praktikanten ins Haus gebracht: Malte (links im Bild) und Luca (in der Mitte). Die Vorbereitung dieser Aktion war recht ungefähr, weil ich einen der beiden nicht sehr gut, den anderen gar nicht kannte. Aber ich wollte schon wie einst mein erster Meister (siehe Teil 1) ein Werk fabrizieren, das wir alle drei auch noch Jahre später gern in den Händen halten würden.
 Mein letztes Schulprojekt mit einer Arbeitsgemeinschaft einer Freien Schule hatte ich mit 12jährigen absolviert, in diesem Alter war man im Mittelalter fast erwachsen. Davor hatte ich mehrere Semester Studenten unterrichtet, die zum Arbeiten keiner Überredung und Lockung bedurften. Daß ich familiär mit einem Kind Umgang pflegte, liegt lange zurück, das Kind studiert heute Jura. Also viel Übung hatte ich nicht mehr.
Mein letztes Schulprojekt mit einer Arbeitsgemeinschaft einer Freien Schule hatte ich mit 12jährigen absolviert, in diesem Alter war man im Mittelalter fast erwachsen. Davor hatte ich mehrere Semester Studenten unterrichtet, die zum Arbeiten keiner Überredung und Lockung bedurften. Daß ich familiär mit einem Kind Umgang pflegte, liegt lange zurück, das Kind studiert heute Jura. Also viel Übung hatte ich nicht mehr.  Wichtig war mir, daß meine Gäste sich in der Werkstatt wohlfühlten. Je jünger ein Mensch ist und je geringer das, was wir Einsichtsvermögen nennen, desto ernster muß die individuelle Freiheit genommen werden. Außerdem sind uns gerade bei Erinnerung an die eigene Kindheit heutige Kinder und ihre Lebenswelt doch so fern, daß wir Kindern zutrauen sollten selbst zu wissen, was für sie gut ist. Zumal man gerade das am besten lernt, wenn man es übt. Soweit die Theorie. Als einer der Gäste nach der ersten Zeile im Winkelhaken keine Lust mehr hatte und auf den Hof verschwand, war ich im ersten Moment doch enttäuscht. Aber man kann einem Erwachsenen wohl sagen, daß manche Arbeit am Anfang schwer ist und er durchhalten möge und ein Lohn sich einstellen werde. Spricht man so zu einem Kind und baut womöglich Druck auf, riskiert man, manifeste Ablehnung zu provozieren. Also hielt ich die Klappe und übte mich nach Kräften in Langmut. Dieses Vorgehen wird an unseren staatlichen Schulen leider nicht in Erwägung gezogen, da eine Lehre im Lehrplan steht, die sehr eingeschränkte Begriffe von Bildung und Ordnung hat und keinen von Freiheit, Persönlichkeit und Eigensinn. Sicherlich ist schon herausgeklungen (und habe ich im letzten Beitrag ausgeführt), wie wenig mir die Pädagogik als Wissenschaft oder Methode einleuchtet. (Meine Diplom-Arbeit als Sozialpädagoge habe ich über die Mißlichkeit des Erziehungsgedankens im Vollzug der Untersuchungshaft von Jugendlichen geschrieben.) Und nun ergab sich meine durch antipädagogische Theorie leicht zu gewinnende Einsicht, daß wir zwischendurch immer mal wieder eine Eichelschlacht auf dem Hof und dergleichen einlegen mußten, weil meine Gäste ein stärkeres Bedürfnis nach Bewegung hatten als etwa Design-Studenten.
Wichtig war mir, daß meine Gäste sich in der Werkstatt wohlfühlten. Je jünger ein Mensch ist und je geringer das, was wir Einsichtsvermögen nennen, desto ernster muß die individuelle Freiheit genommen werden. Außerdem sind uns gerade bei Erinnerung an die eigene Kindheit heutige Kinder und ihre Lebenswelt doch so fern, daß wir Kindern zutrauen sollten selbst zu wissen, was für sie gut ist. Zumal man gerade das am besten lernt, wenn man es übt. Soweit die Theorie. Als einer der Gäste nach der ersten Zeile im Winkelhaken keine Lust mehr hatte und auf den Hof verschwand, war ich im ersten Moment doch enttäuscht. Aber man kann einem Erwachsenen wohl sagen, daß manche Arbeit am Anfang schwer ist und er durchhalten möge und ein Lohn sich einstellen werde. Spricht man so zu einem Kind und baut womöglich Druck auf, riskiert man, manifeste Ablehnung zu provozieren. Also hielt ich die Klappe und übte mich nach Kräften in Langmut. Dieses Vorgehen wird an unseren staatlichen Schulen leider nicht in Erwägung gezogen, da eine Lehre im Lehrplan steht, die sehr eingeschränkte Begriffe von Bildung und Ordnung hat und keinen von Freiheit, Persönlichkeit und Eigensinn. Sicherlich ist schon herausgeklungen (und habe ich im letzten Beitrag ausgeführt), wie wenig mir die Pädagogik als Wissenschaft oder Methode einleuchtet. (Meine Diplom-Arbeit als Sozialpädagoge habe ich über die Mißlichkeit des Erziehungsgedankens im Vollzug der Untersuchungshaft von Jugendlichen geschrieben.) Und nun ergab sich meine durch antipädagogische Theorie leicht zu gewinnende Einsicht, daß wir zwischendurch immer mal wieder eine Eichelschlacht auf dem Hof und dergleichen einlegen mußten, weil meine Gäste ein stärkeres Bedürfnis nach Bewegung hatten als etwa Design-Studenten.
 Wir haben mit meiner Langmut-Übung und ohne Streß immerhin binnen fünf halben Tagen ein Büchlein in Broschurform angefertigt. Grundlage ist ein Gedicht von Christian Morgenstern: „Neue Bildungen, der Natur vorgeschlagen“ (siehe Fotos). Diesen Text haben wir durch eigene Schöpfungen ergänzt, was den Titel des Werkes, genauer: die Autorenzeile erklärt.
Wir haben mit meiner Langmut-Übung und ohne Streß immerhin binnen fünf halben Tagen ein Büchlein in Broschurform angefertigt. Grundlage ist ein Gedicht von Christian Morgenstern: „Neue Bildungen, der Natur vorgeschlagen“ (siehe Fotos). Diesen Text haben wir durch eigene Schöpfungen ergänzt, was den Titel des Werkes, genauer: die Autorenzeile erklärt.  Er ist gesetzt aus Futura schmalhalbfett, Futura Buch und Steiler Futura. Die Morgenstern-Zeilen innen sind in braun gedruckt, unsere Erfindungen blau. Das nächste Bild zeigt links drei Morgenstern-Zeilen in Garamond und rechts drei Schöpfungen von uns in Schreibmaschinenschrift und Futura schmalmager. Meine Seitenplanung geriet schnell durcheinander,
Er ist gesetzt aus Futura schmalhalbfett, Futura Buch und Steiler Futura. Die Morgenstern-Zeilen innen sind in braun gedruckt, unsere Erfindungen blau. Das nächste Bild zeigt links drei Morgenstern-Zeilen in Garamond und rechts drei Schöpfungen von uns in Schreibmaschinenschrift und Futura schmalmager. Meine Seitenplanung geriet schnell durcheinander,  nicht nur wegen der amüsanten Ablenkungen, sondern weil ich in der Werkstatt auch immerzu auf alle möglichen Gefahrenquellen achten mußte und Sicherheitsbelehrungen wiederholen. (Es ist auch kein Unfall passiert.) Aber als Handwerker ist man an Improvisation gewöhnt, so daß das Büchlein zwar nicht wie geplant, aber ausreichend adrett entstehen konnte.
nicht nur wegen der amüsanten Ablenkungen, sondern weil ich in der Werkstatt auch immerzu auf alle möglichen Gefahrenquellen achten mußte und Sicherheitsbelehrungen wiederholen. (Es ist auch kein Unfall passiert.) Aber als Handwerker ist man an Improvisation gewöhnt, so daß das Büchlein zwar nicht wie geplant, aber ausreichend adrett entstehen konnte.
 Das nächste Foto zeigt magere und dreiviertelfette Futura. Danach links die „Gier(!)affenschlange“ in magerer Pracht-Antiqua und rechts Morgensternzeilen in schmalfetter Pracht-Antiqua mit einem Linolschnitt. Geplant hatte ich, daß die Praktikanten den Linolschnitt anfertigen, aber das Material ist so hart, daß ich für den Walfischvogel selbst
Das nächste Foto zeigt magere und dreiviertelfette Futura. Danach links die „Gier(!)affenschlange“ in magerer Pracht-Antiqua und rechts Morgensternzeilen in schmalfetter Pracht-Antiqua mit einem Linolschnitt. Geplant hatte ich, daß die Praktikanten den Linolschnitt anfertigen, aber das Material ist so hart, daß ich für den Walfischvogel selbst  zu den Messern griff. Inzwischen hatten sich die beiden die Arbeit klassisch geteilt: Malte war als Schriftsetzer tätig. Er fand sich im Setzkasten erstaunlich schnell zurecht. Die Lettern liegen darin in etwa 125 Fächer verteilt. Freilich mußte Malte nicht wissen, wo die Buchstaben mit Akzenten liegen, aber er merkte sich sehr fix, wo er die häufigsten Typen finden würde. Luca arbeitete an der Presse als Buchdrucker. Es gibt an meiner Maschine eine Schwachstelle: Der Walzenlauf ist etwas ungünstig konstruiert, die Walzen springen an einer Stelle, wenn man den Hebel ohne Feingefühl führt. Luca hatte das bald intuitiv im Griff. Das etwas schwierigere Einrichten der Druckform oblag mir.
zu den Messern griff. Inzwischen hatten sich die beiden die Arbeit klassisch geteilt: Malte war als Schriftsetzer tätig. Er fand sich im Setzkasten erstaunlich schnell zurecht. Die Lettern liegen darin in etwa 125 Fächer verteilt. Freilich mußte Malte nicht wissen, wo die Buchstaben mit Akzenten liegen, aber er merkte sich sehr fix, wo er die häufigsten Typen finden würde. Luca arbeitete an der Presse als Buchdrucker. Es gibt an meiner Maschine eine Schwachstelle: Der Walzenlauf ist etwas ungünstig konstruiert, die Walzen springen an einer Stelle, wenn man den Hebel ohne Feingefühl führt. Luca hatte das bald intuitiv im Griff. Das etwas schwierigere Einrichten der Druckform oblag mir.  An der Papierschneidemaschine arbeiteten wir zu dritt. Es handelt sich dabei um die einzige moderne Maschine meiner Werkstatt, eine große Wohlenberg mit Lichtschranke, so daß Unfälle mit dem Messer ausgeschlossen sind. Freilich stand ich beim Schneiden immer dabei. Und das Einbinden mit Nadel und Garn erledigte ich am Ende allein, eine Woche ist für ein solches Projekt nicht viel.
An der Papierschneidemaschine arbeiteten wir zu dritt. Es handelt sich dabei um die einzige moderne Maschine meiner Werkstatt, eine große Wohlenberg mit Lichtschranke, so daß Unfälle mit dem Messer ausgeschlossen sind. Freilich stand ich beim Schneiden immer dabei. Und das Einbinden mit Nadel und Garn erledigte ich am Ende allein, eine Woche ist für ein solches Projekt nicht viel.
 Auf dem nächsten Bild ist die Gänseschmalzblume aus Excelsior (Englische Schreibschrift/Anglaise) gesetzt, darunter eine halbfette kursive Fundamental. Rechts die Unger-Fraktur, über die ich früher schon geschrieben habe. Sie ist so gut lesbar wegen ihrer Nähe zu unserer Antiqua. Der Linolschnitt drückt erstens durch, weil das Papier sehr lichtdurchlässig ist (geringe Opazität), und ein bißchen Farbe hat auch abgezogen, wir hatten einfach nicht genügend Trockenzeit in der einen Woche. Auf der letzten Seite das Impressum in kursiver und gewöhnlicher Garamond.
Auf dem nächsten Bild ist die Gänseschmalzblume aus Excelsior (Englische Schreibschrift/Anglaise) gesetzt, darunter eine halbfette kursive Fundamental. Rechts die Unger-Fraktur, über die ich früher schon geschrieben habe. Sie ist so gut lesbar wegen ihrer Nähe zu unserer Antiqua. Der Linolschnitt drückt erstens durch, weil das Papier sehr lichtdurchlässig ist (geringe Opazität), und ein bißchen Farbe hat auch abgezogen, wir hatten einfach nicht genügend Trockenzeit in der einen Woche. Auf der letzten Seite das Impressum in kursiver und gewöhnlicher Garamond.
Zu Hause haben wir einmal versucht zu pokern, weil die Jungs pokern wollten. Die Regeln dafür fanden wir im Internet, aber sie erschienen uns zu kompliziert. Außerdem fehlte es uns an Geld. Doch wozu waren wir  täglich in einer Offizin? Geld an sich ist bekanntlich schnöde, aber es ist eine Art Urkunde für einen Tauschwert und wird deshalb oft fein entworfen. Wie die fette Schrift auf unserem Foto heißt, weiß ich leider nicht. Werde mal im Forum des Bleisetzers fragen. Solche häßlichen Schriften nannten wir in der Druckerei Rapputan, wo ich früher Schriftsetzer war, Klamottenschriften. Das erscheint mir heute noch mir passend.
täglich in einer Offizin? Geld an sich ist bekanntlich schnöde, aber es ist eine Art Urkunde für einen Tauschwert und wird deshalb oft fein entworfen. Wie die fette Schrift auf unserem Foto heißt, weiß ich leider nicht. Werde mal im Forum des Bleisetzers fragen. Solche häßlichen Schriften nannten wir in der Druckerei Rapputan, wo ich früher Schriftsetzer war, Klamottenschriften. Das erscheint mir heute noch mir passend.
Aktualisierung: Das Bleisetzer-Forum wird von einem Kenner der Bleisatzschriften gelesen, der mir nun schrieb: “Die gesuchte “50 Euro”-Schrift heißt Belvedere, von der Bauerschen Gießerei. Entwerfer war Heinrich Wieynck 1906.”
Als ich mich bei Luca und Malte erkundigte, wie die Bank denn heißen solle, die unsere Note herausgibt, sagte Luca sofort: „Bescheuerte Bank“. Dies deuchte uns nach kurzer Beratung überaus geeignet.
Mit dem Pokern hat es dann nicht recht geklappt, weil wir keine vernünftigen Regeln erfinden konnten. Luca hat öfter versucht, Einkäufe und Museums-Billetts mit unserem Geld zu bezahlen, aber die Note der Bescheuerten Bank fand keine Akzeptanz. Obwohl der Name dieser Bank aus der Chevalier gesetzt ist. Formen einer solchen Schrift finden sich auch auf der Dollar-Note.
Gearbeitet habe ich in dieser einen Woche freilich nicht. Nur ein paarmal kam Kundschaft, um Ware abzuholen, die ich in der Vorwoche gedruckt hatte, wobei auch das Foto von uns dreien entstand, für das wir Susanne Fleck herzlich danken. In der Werkstatt habe ich vor Trubel das Fotografieren schlicht vergessen.
Ich war etwas in Sorge, daß meine beiden unbefangenen Gäste zuviel mit meinen Kunden reden würden, interne Betriebsangelegenheiten ausplaudern, aber meine Kunden waren von meinen Gästen sehr angetan. Ich hatte bald das Gefühl, es wäre förderlich fürs Geschäft, zwei freundliche Buben Konversation treiben zu lassen. Meine Kunden schauten sich an, wie weit es die Papierflieger auf der Straße brachten und ließen sich auch Mitbringsel aus dem Naturkundemuseum vorführen.
Mir war nach einer Woche wieder einmal deutlich geworden, welches Vergnügen den Erwachsenen in ihrer abgeschlossenen Arbeitswelt entgeht, wenn sie Kinder in einer abgeschlossenen Schulwelt aufbewahren und sich nur abends treffen. Und für Kinder wäre es freilich auch interessant, mehr von der Arbeitswelt mitzubekommen. Zwar spielt sich Arbeit viel im Büro ab, aber ich fand es als Kind absolut großartig, wenn mich meine Eltern in ihre Büros mitnahmen: meine Mutter, die ein Bilderbuchlektorat leitete, in den Kinderbuchverlag Berlin, mein Vater, Mitglied der Chefredaktion, in die Redaktion der NBI (Neue Berliner Illustrierte). Ich konnte mich dort frei bewegen und lernte viele Leute und ihre Arbeitsplätze kennen. Am aufregendsten war, als mich ein Fotograf der Illustrierten mit in ein Museum nahm, wo ich schwarzen Stoff hinter Vitrinen hielt, damit er blendfrei fotografieren konnte. Mit eitel Freude betrachtete ich die Bilder später in der Illustrierten – und fand vor allem den schwarzen Hintergrund überaus gelungen. Und ich hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was meine Eltern tagsüber anstellten.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [4]
Junge Setzer und Drucker, Teil 1 · 5. Dezember 2007
Kürzlich erzählte ich hier von dem Beginn meiner Zuneigung zum Bleisatz, entstanden in der Arbeitsgemeinschaft “Junge Schriftsetzer” im Berliner “Pionierpalast”, einem phänomenalen,  in der DDR einmaligen Freizeithaus für Kinder und Jugendliche im “Pionierpark” mit “Pioniereisenbahn” in der Berliner Wuhlheide, und von meiner Lehrzeit. Ich habe nicht viel aufbewahrt aus dieser Zeit meiner frühen Jugend, wir haben Postkarten, Plakate, Briefpapier, Visitenkarten gedruckt. Nicht nur meine Familie, die halbe Schulklasse habe ich mit Visitenkarten ausgestattet. Aber zwei Büchlein sind doch noch da. Ich zeige sie hier auf einigen Fotos.
in der DDR einmaligen Freizeithaus für Kinder und Jugendliche im “Pionierpark” mit “Pioniereisenbahn” in der Berliner Wuhlheide, und von meiner Lehrzeit. Ich habe nicht viel aufbewahrt aus dieser Zeit meiner frühen Jugend, wir haben Postkarten, Plakate, Briefpapier, Visitenkarten gedruckt. Nicht nur meine Familie, die halbe Schulklasse habe ich mit Visitenkarten ausgestattet. Aber zwei Büchlein sind doch noch da. Ich zeige sie hier auf einigen Fotos.
 Die typografische und satztechnische Beschaffenheit dieser Büchlein ist von solider Güte. Ich war damals stolz auf dieses Gemeinschaftswerk mehrerer Jugendlicher und Kinder (der Jüngste war zehn Jahre alt), und ich bin es heute noch. Und zwar nicht, weil ich an irgendeiner Drucksache gearbeitet habe, sondern weil dieses Buch den Anforderungen
Die typografische und satztechnische Beschaffenheit dieser Büchlein ist von solider Güte. Ich war damals stolz auf dieses Gemeinschaftswerk mehrerer Jugendlicher und Kinder (der Jüngste war zehn Jahre alt), und ich bin es heute noch. Und zwar nicht, weil ich an irgendeiner Drucksache gearbeitet habe, sondern weil dieses Buch den Anforderungen genügt, die gebildete Menschen an ein Buch stellen, egal wie alt sie sind. Unser Meister Wolfgang Holtz war einerseits ein großer Pädagoge, indem er uns lehrte, wie die Dinge gemacht werden und man dem Machen Freude abgewinnt; er war andererseits ein Antipädagoge, weil er unter einem kindgerechten Buch nichts Niedliches verstand, sondern beispielsweise ein
genügt, die gebildete Menschen an ein Buch stellen, egal wie alt sie sind. Unser Meister Wolfgang Holtz war einerseits ein großer Pädagoge, indem er uns lehrte, wie die Dinge gemacht werden und man dem Machen Freude abgewinnt; er war andererseits ein Antipädagoge, weil er unter einem kindgerechten Buch nichts Niedliches verstand, sondern beispielsweise ein  angemessenes Format für kleinere Hände, kleine Schriften für gute Augen, gut geschriebene, verständliche Texte für einen kindlichen Sinn. Er hat diese Bücher nicht aus falsch verstandener kindlicher Perspektive entwickelt, die oftmals nur dümmlich wirkt, sondern in unserem Sinne für unsere Bildung. Wir haben gelernt, wie man ein Buch macht, also auch, was ein Buch ist. Wir
angemessenes Format für kleinere Hände, kleine Schriften für gute Augen, gut geschriebene, verständliche Texte für einen kindlichen Sinn. Er hat diese Bücher nicht aus falsch verstandener kindlicher Perspektive entwickelt, die oftmals nur dümmlich wirkt, sondern in unserem Sinne für unsere Bildung. Wir haben gelernt, wie man ein Buch macht, also auch, was ein Buch ist. Wir  hatten es nicht mit einem Lehrer zu tun, der unserer Phantasie freien Lauf ließ. Phantasie ist in der Typographie zwar gefragt, aber sie muß gelenkt werden, sie entfaltet sich in starken kulturellen Grenzen, sonst kommt Quatsch heraus. Vernünftige Kinder sind dieser Art der aus der fiktiven Höhe aufs vermeintlich naive Gemüt herabgeneigten Quatschvermittlung (“auf Augenhöhe” – begibt man sich mit geschrumpften Senioren auch auf eine solche?) kaum zugeneigt.
hatten es nicht mit einem Lehrer zu tun, der unserer Phantasie freien Lauf ließ. Phantasie ist in der Typographie zwar gefragt, aber sie muß gelenkt werden, sie entfaltet sich in starken kulturellen Grenzen, sonst kommt Quatsch heraus. Vernünftige Kinder sind dieser Art der aus der fiktiven Höhe aufs vermeintlich naive Gemüt herabgeneigten Quatschvermittlung (“auf Augenhöhe” – begibt man sich mit geschrumpften Senioren auch auf eine solche?) kaum zugeneigt.
 Ich habe in der Schule nie die Zufriedenheit über einen Bildungszuwachs erlebt, wie ich sie in der Arbeitsgemeinschaft gewann. In der Schule wurde mir mein interessegeleitetes Lernen als Fehlverhalten vorgeworfen; in der Arbeitsgemeinschaft „Junge Schriftsetzer“ wurde nur gelernt, was interessierte, und das reichte immerhin dafür, daß ich im ersten
Ich habe in der Schule nie die Zufriedenheit über einen Bildungszuwachs erlebt, wie ich sie in der Arbeitsgemeinschaft gewann. In der Schule wurde mir mein interessegeleitetes Lernen als Fehlverhalten vorgeworfen; in der Arbeitsgemeinschaft „Junge Schriftsetzer“ wurde nur gelernt, was interessierte, und das reichte immerhin dafür, daß ich im ersten  halben Jahr meiner Lehre kaum neues erfuhr. Aus der Befriedigung von Interesse erwächst Lernbegierde. Erfolgreich lernt nur, wer sich für etwas interessiert. Ich war kein guter Schüler, aber ich hatte Interessen, und aus Interessen erwächst Antrieb und Erfolg. In der Beurteilung meiner Schule hätte gestanden, daß sie nicht in der Lage war, mein Interesse an Themen zu
halben Jahr meiner Lehre kaum neues erfuhr. Aus der Befriedigung von Interesse erwächst Lernbegierde. Erfolgreich lernt nur, wer sich für etwas interessiert. Ich war kein guter Schüler, aber ich hatte Interessen, und aus Interessen erwächst Antrieb und Erfolg. In der Beurteilung meiner Schule hätte gestanden, daß sie nicht in der Lage war, mein Interesse an Themen zu  erwecken, die höchst interessant sind. Wolfgang Holtz konnte das – und ich würde ihm unterstellen, daß er keine erzieherischen Ambitionen hatte, sondern seine Freude an der Arbeit mit uns teilen wollte. Er hatte es freilich auch leicht in einer Umgebung, in der die Sache, die Technik, Aufmerksamkeit fordert und die Menschen nicht zum Erscheinen gezwungen werden. Ich fühlte mich dort so wohl, daß ich nicht nur einmal pro Woche, wie es vorgesehen war, meine Zeit dort verbrachte, sondern viele Nachmittage. Manchmal kam man auch nur, um den andern zuzugucken, am Tisch zu sitzen und zu plaudern. Eine Setzerei ist gemütlich.
erwecken, die höchst interessant sind. Wolfgang Holtz konnte das – und ich würde ihm unterstellen, daß er keine erzieherischen Ambitionen hatte, sondern seine Freude an der Arbeit mit uns teilen wollte. Er hatte es freilich auch leicht in einer Umgebung, in der die Sache, die Technik, Aufmerksamkeit fordert und die Menschen nicht zum Erscheinen gezwungen werden. Ich fühlte mich dort so wohl, daß ich nicht nur einmal pro Woche, wie es vorgesehen war, meine Zeit dort verbrachte, sondern viele Nachmittage. Manchmal kam man auch nur, um den andern zuzugucken, am Tisch zu sitzen und zu plaudern. Eine Setzerei ist gemütlich.
 Auf den ersten Fotos ist ein ABC-Buch aus der Druckerei abgebildet. Wir haben das Buch selbst in Leinen gebunden. Erläuterungen: Eine Hochzeit ist ein doppelt gesetztes Wort oder ein doppelt gesetzter Satzteil. Eine Leiche ist das Gegenteil davon: fehlende Wörter. Ein Fliegenkopf ist das Abbild einer auf dem Kopf stehenden Type, also im Satzbild ein Fleck
Auf den ersten Fotos ist ein ABC-Buch aus der Druckerei abgebildet. Wir haben das Buch selbst in Leinen gebunden. Erläuterungen: Eine Hochzeit ist ein doppelt gesetztes Wort oder ein doppelt gesetzter Satzteil. Eine Leiche ist das Gegenteil davon: fehlende Wörter. Ein Fliegenkopf ist das Abbild einer auf dem Kopf stehenden Type, also im Satzbild ein Fleck  anstelle eines Buchstaben. Ein Satzschiff ist ein schweres Blech, auf dem man Bleisatz-Kolumnen transportiert und aufbewahrt, es dient auch als Arbeitsunterlage. Versalien sind Großbuchstaben, Gemeine sind Kleinbuchstaben, und Flattersatz ist eine Satzform ohne Worttrennungen, in der die Zeilenlänge dem Zufall, dem Sinn oder dem typografischen Entwurf
anstelle eines Buchstaben. Ein Satzschiff ist ein schweres Blech, auf dem man Bleisatz-Kolumnen transportiert und aufbewahrt, es dient auch als Arbeitsunterlage. Versalien sind Großbuchstaben, Gemeine sind Kleinbuchstaben, und Flattersatz ist eine Satzform ohne Worttrennungen, in der die Zeilenlänge dem Zufall, dem Sinn oder dem typografischen Entwurf  untergeordnet wird. Im glatten Satz (heute Blocksatz genannt) werden nach dem Setzen einer Zeile die Wortabstände geändert, um eine bestimmte Länge der Zeile zu erreichen. Quadraten, Stege, Ausschluß (sind / im Satz gewöhnlich blind; der Reim schwirrt mit heute noch durch den Kopf) werden nicht-druckende Teile genannt, ohne welche die Lettern keinen Halt hätten.
untergeordnet wird. Im glatten Satz (heute Blocksatz genannt) werden nach dem Setzen einer Zeile die Wortabstände geändert, um eine bestimmte Länge der Zeile zu erreichen. Quadraten, Stege, Ausschluß (sind / im Satz gewöhnlich blind; der Reim schwirrt mit heute noch durch den Kopf) werden nicht-druckende Teile genannt, ohne welche die Lettern keinen Halt hätten.  Spieße werden Teile genannt, die während des Druckes durch die Erschütterungen der Druckmaschine aufsteigen auf Schrifthöhe und dann mitdrucken. Garamond, Didot und Super sind Namen von Schriften: Garamond-Antiqua, Didot-Antiqua, Super-Grotesk. „Unsre alte Boston“ ist die Bostonpresse, auch Bostontiegel. Eine in Boston, der Hauptstadt Massachusetts,
Spieße werden Teile genannt, die während des Druckes durch die Erschütterungen der Druckmaschine aufsteigen auf Schrifthöhe und dann mitdrucken. Garamond, Didot und Super sind Namen von Schriften: Garamond-Antiqua, Didot-Antiqua, Super-Grotesk. „Unsre alte Boston“ ist die Bostonpresse, auch Bostontiegel. Eine in Boston, der Hauptstadt Massachusetts,  von der Maschinenfabrik William H. Golding (1845 – 1916) um 1870 entwickelte Klapptiegeldruckpresse. In meiner Werkstatt steht ein Original aus Boston (Golding presses have the name Golding & Co. cast into the body of the press), ich drucke allerdings nicht damit, weil sie nicht so leicht justierbar ist wie die nach 1900 gebauten. Ich müßte mit Leder- und Papierstreifen die Walzenhöhe einstellen. Man hat später die Laufleisten für die Walzen durch Schrauben verstellbar gemacht.
von der Maschinenfabrik William H. Golding (1845 – 1916) um 1870 entwickelte Klapptiegeldruckpresse. In meiner Werkstatt steht ein Original aus Boston (Golding presses have the name Golding & Co. cast into the body of the press), ich drucke allerdings nicht damit, weil sie nicht so leicht justierbar ist wie die nach 1900 gebauten. Ich müßte mit Leder- und Papierstreifen die Walzenhöhe einstellen. Man hat später die Laufleisten für die Walzen durch Schrauben verstellbar gemacht.
 Das Foto mit der X-Seite aus dem ABC-Büchlein zeigt einen Abzug des Rahmens. Ich wüßte sonst nicht mehr, daß ich diesen Rahmen 1981 gesetzt habe. Im Z-Spruch ist das Lang-s verwendet worden. Unser Meister hatte keine Angst davor, uns auch mit alten Bräuchen vertraut zu machen. Im Bleisatz dieser kursiven Garamond von Typoart war das lang s enthalten.
Das Foto mit der X-Seite aus dem ABC-Büchlein zeigt einen Abzug des Rahmens. Ich wüßte sonst nicht mehr, daß ich diesen Rahmen 1981 gesetzt habe. Im Z-Spruch ist das Lang-s verwendet worden. Unser Meister hatte keine Angst davor, uns auch mit alten Bräuchen vertraut zu machen. Im Bleisatz dieser kursiven Garamond von Typoart war das lang s enthalten.
Schließlich das Impressum, wo unsere Namen erstmals in einem echten, richtigen, gedruckten Buch erschienen. Wir waren sehr zufrieden.
 Das „Fachwörterbüchlein“ kommt mit einem recht prächtigen Haupttitel in zweifarbigem Druck daher. Die Entwürfe für diese Arbeiten wird der Meister Wolfgang Holtz wohl beeinflußt, wenn nicht selbst gemacht haben. Daran ist auch für einen Typografen nicht viel zu verbessern. Vielleicht ein wenig Randausgleich und Versalienharmonisierung, aber das ist auch Ansichtssache.
Das „Fachwörterbüchlein“ kommt mit einem recht prächtigen Haupttitel in zweifarbigem Druck daher. Die Entwürfe für diese Arbeiten wird der Meister Wolfgang Holtz wohl beeinflußt, wenn nicht selbst gemacht haben. Daran ist auch für einen Typografen nicht viel zu verbessern. Vielleicht ein wenig Randausgleich und Versalienharmonisierung, aber das ist auch Ansichtssache.
 Auf Seite 25 wird erklärt, was Leichen, Fliegenköpfe und Spieße sind, mit einem Grammatikfehler am Ende des Satzes. Es gibt übrigens auch das Verb zum Spieß: eine Druckform spießt, sagt man, wenn Blindmaterial mitdruckt. Auf Seite 28 ist mein erster Linolschnitt zu sehen, ich habe mir zur Illustration die Bleilaus ausgesucht. Es gibt übrigens ein etwas
Auf Seite 25 wird erklärt, was Leichen, Fliegenköpfe und Spieße sind, mit einem Grammatikfehler am Ende des Satzes. Es gibt übrigens auch das Verb zum Spieß: eine Druckform spießt, sagt man, wenn Blindmaterial mitdruckt. Auf Seite 28 ist mein erster Linolschnitt zu sehen, ich habe mir zur Illustration die Bleilaus ausgesucht. Es gibt übrigens ein etwas  böses Spiel in der Druckerei: Jemandem „Bleiläuse zeigen“. Wolfgang Holtz hat mir Bleiläuse gezeigt, ein netter älterer Herr mit Bart und Brille und dann doch ein Kindskopf. Ich war hinterher zwar etwas naß, aber ihm nicht böse. Wir haben ihn alle sehr gemocht. Heute glaube ich, weil er nie an uns herumnörgelte und uns nicht erziehen wollte. In einer durchpädagogisierten Welt wie der DDR hatten es Erwachsene ohne den Willen zur Menschenformung nach einem (sozialistischen) Bilde mit Kindern schon viel leichter durch den entspannten Umgang.
böses Spiel in der Druckerei: Jemandem „Bleiläuse zeigen“. Wolfgang Holtz hat mir Bleiläuse gezeigt, ein netter älterer Herr mit Bart und Brille und dann doch ein Kindskopf. Ich war hinterher zwar etwas naß, aber ihm nicht böse. Wir haben ihn alle sehr gemocht. Heute glaube ich, weil er nie an uns herumnörgelte und uns nicht erziehen wollte. In einer durchpädagogisierten Welt wie der DDR hatten es Erwachsene ohne den Willen zur Menschenformung nach einem (sozialistischen) Bilde mit Kindern schon viel leichter durch den entspannten Umgang.
Und auf der letzten Seite das Impressum mit der in der DDR unvermeidlichen Druckgenehmigungsnummer. Du liebe Güte!
 Gelegentlich unterrichte ich Bleisatz. An der Potsdamer Fachhochschule erfüllte ich einige Semester lang einen Lehrauftrag im Fachbereich Design, bis ich keine Zeit mehr hatte, eine unterbezahlte Tätigkeit auszuüben. Vielleicht biete ich später mal wieder etwas an. Es hat Spaß gemacht, und ich habe immerhin einen Mitarbeiter für meine Werkstatt gewonnen, der kalligrafische und typografische Aufträge übernimmt. Kinder habe ich öfter unterrichtet, oft auch gratis, weil das eine vergnügliche Abwechslung ist.
Gelegentlich unterrichte ich Bleisatz. An der Potsdamer Fachhochschule erfüllte ich einige Semester lang einen Lehrauftrag im Fachbereich Design, bis ich keine Zeit mehr hatte, eine unterbezahlte Tätigkeit auszuüben. Vielleicht biete ich später mal wieder etwas an. Es hat Spaß gemacht, und ich habe immerhin einen Mitarbeiter für meine Werkstatt gewonnen, der kalligrafische und typografische Aufträge übernimmt. Kinder habe ich öfter unterrichtet, oft auch gratis, weil das eine vergnügliche Abwechslung ist.
 Pädagogik ist keine Wissenschaft. Wissenschaftlich wäre, wenn ich eine Maßnahme A auf ein Kind B anwenden kann und ein Ergebnis C erhalte. Methodik und Didaktik funktionieren so aber nicht. Man sagt, daß es gute und schlechte Pädagogen gibt. Richtig ist: es gibt keine Pädagogen, sondern Menschen, die methodisches und didaktisches Vorgehen mehr oder minder in
Pädagogik ist keine Wissenschaft. Wissenschaftlich wäre, wenn ich eine Maßnahme A auf ein Kind B anwenden kann und ein Ergebnis C erhalte. Methodik und Didaktik funktionieren so aber nicht. Man sagt, daß es gute und schlechte Pädagogen gibt. Richtig ist: es gibt keine Pädagogen, sondern Menschen, die methodisches und didaktisches Vorgehen mehr oder minder in  Übereinstimmung mit Bedürfnissen anderer Menschen bringen. Wenn Grundschullehrer, die in der Regel typografisch unbeleckt sind, jungen Menschen eines Jahrganges ohne ausreichende Rücksicht auf individuelle Entwicklung Lesen und Schreiben „beibringen“, ist das Glückssache. Und grundsätzlich eher ein Problem des Systems als des einzelnen Lehrers. Wenn’s nicht klappt, stehen geschäftstüchtige
Übereinstimmung mit Bedürfnissen anderer Menschen bringen. Wenn Grundschullehrer, die in der Regel typografisch unbeleckt sind, jungen Menschen eines Jahrganges ohne ausreichende Rücksicht auf individuelle Entwicklung Lesen und Schreiben „beibringen“, ist das Glückssache. Und grundsätzlich eher ein Problem des Systems als des einzelnen Lehrers. Wenn’s nicht klappt, stehen geschäftstüchtige  Psychologen in einem Unterstützungssystem mit Diagnosen phantastischer Mißlichkeiten bereit: Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit Hyperaktivität oder Legasthenie. Treppenwitze der Schwarzen Pädagogik. Ein Typograph muß sich nur die überdimensionierten Fibeln anschauen und die serifenlosen und zu großen Druckschriften darin, um das programmierte Scheitern zu erkennen. Viele
Psychologen in einem Unterstützungssystem mit Diagnosen phantastischer Mißlichkeiten bereit: Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit Hyperaktivität oder Legasthenie. Treppenwitze der Schwarzen Pädagogik. Ein Typograph muß sich nur die überdimensionierten Fibeln anschauen und die serifenlosen und zu großen Druckschriften darin, um das programmierte Scheitern zu erkennen. Viele  Kinder lernen lesen trotz Schule. Ich habe übrigens an Ladenschildern lesen gelernt. Ich wollte wissen, was sie bedeuten, und meine Mutter hat es mir verraten. Meine ersten Wörter waren FLEISCHEREI, MILCH, HUTMODEN und so weiter. Das Gestammel „Mama am Haus“, „Oma im Garten“, das in meiner Schulfibel stand, hat die Schule in meinen Augen erniedrigt.
Kinder lernen lesen trotz Schule. Ich habe übrigens an Ladenschildern lesen gelernt. Ich wollte wissen, was sie bedeuten, und meine Mutter hat es mir verraten. Meine ersten Wörter waren FLEISCHEREI, MILCH, HUTMODEN und so weiter. Das Gestammel „Mama am Haus“, „Oma im Garten“, das in meiner Schulfibel stand, hat die Schule in meinen Augen erniedrigt.
 In der Druckerei hatte ich meistens mit Kindern zu tun, denen Buchstaben bereits vertraut waren. Aber auch ein 4jähriger ist in meiner Druckerei in Juchzen ausgebrochen, als er, auf einem Podest an der Presse stehend, den ersten Abzug seines Namens fertigte, dessen Züge er schon kannte. Lesen und Schreiben lehrt sich am besten in
In der Druckerei hatte ich meistens mit Kindern zu tun, denen Buchstaben bereits vertraut waren. Aber auch ein 4jähriger ist in meiner Druckerei in Juchzen ausgebrochen, als er, auf einem Podest an der Presse stehend, den ersten Abzug seines Namens fertigte, dessen Züge er schon kannte. Lesen und Schreiben lehrt sich am besten in  Verbindung mit Sinngebung, so wie es auch benutzt wird. Niemand liest um des Lesens willen, sondern weil er etwas erfahren möchte. Die Frage „Was steht da?“ markiert den Punkt, an dem das Lernen beginnt. Nicht: Zwei diagonal und spitz nach oben einander zugeneigte Stöckchen, eine “umgedrehte Schultüte” oder “ein Dach”, mit einem verbindenden Querknüppel in der Mitte bedeuten: A. Speak after me: Aaaa! Aber ja. A wie Abrichtung?
Verbindung mit Sinngebung, so wie es auch benutzt wird. Niemand liest um des Lesens willen, sondern weil er etwas erfahren möchte. Die Frage „Was steht da?“ markiert den Punkt, an dem das Lernen beginnt. Nicht: Zwei diagonal und spitz nach oben einander zugeneigte Stöckchen, eine “umgedrehte Schultüte” oder “ein Dach”, mit einem verbindenden Querknüppel in der Mitte bedeuten: A. Speak after me: Aaaa! Aber ja. A wie Abrichtung?
 Im vergangenen Sommer waren Malte und Luca eine Woche lang meine Gäste. Vormittags arbeiteten wir in der Werkstatt (abgesehen von den Eichelschlachten auf dem Hof und der Konstruktion einer Papierflugzeugflotte mit Testflügen auf der Straße), die Nachmittage verbrachten wir mit Amusement: Kino, Tierpark, Naturkundemuseum,
Im vergangenen Sommer waren Malte und Luca eine Woche lang meine Gäste. Vormittags arbeiteten wir in der Werkstatt (abgesehen von den Eichelschlachten auf dem Hof und der Konstruktion einer Papierflugzeugflotte mit Testflügen auf der Straße), die Nachmittage verbrachten wir mit Amusement: Kino, Tierpark, Naturkundemuseum,  Technikmuseum, Aquarium, Fernsehturm, Spielplatz, Buchhandlungen – eine Woche intensive Expeditionen. Und übermorgen zeige ich, was die beiden Praktikanten und ich gedruckt haben. Und welche Gesichter wir dabei machten. Für heute soll es genug sein. Die Druckerey hat dieser Tage viel zu tun, es weihnachtet nach Kräften, weshalb auch die Arbeit am Max-Goldt-Büchlein ruht.
Technikmuseum, Aquarium, Fernsehturm, Spielplatz, Buchhandlungen – eine Woche intensive Expeditionen. Und übermorgen zeige ich, was die beiden Praktikanten und ich gedruckt haben. Und welche Gesichter wir dabei machten. Für heute soll es genug sein. Die Druckerey hat dieser Tage viel zu tun, es weihnachtet nach Kräften, weshalb auch die Arbeit am Max-Goldt-Büchlein ruht.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [7]
Aus meiner Lehrzeit · 21. November 2007
Ich habe als 14jähriger erstmals einen Winkelhaken, das Instrument, in dem der Setzer die Typen sammelt, in die Hand genommen. Ich war als Junge kein Freund von Baugeschehen. Ich habe zwar begeistert Matchbox-Städte gebaut, aber zugleich ein Faible für Verwaltung entwickelt: für Papiere, vorzugsweise Dokumente und Zeitungen: Meiner Großmutter stellte ich einen Personalsauweis aus und mir einen als Kriminalpolizist. Der Stabilbaukasten mit Schienen und Schrauben zog mich nur kurzzeitig an.
Als ich, 14jährig, die Musikschule (Klassisches Akkordeon) nach fünf Jahren, in denen ich recht weit gekommen war und nun ein Jahr lang für eine große Prüfung ein 45minütiges Konzert auswendig lernen sollte, hinwarf, überlegte meine Mutter, wie meine  Freizeit sinnvoller ausgestaltet werden könnte als durch die ungesunden Dinge, die 14jährige sonst gern tun. Zuerst wurde ich zum Tischtennisverein geschickt, aber die Turnhalle stank mir zu sehr, war mir zu groß und zu laut. Dann machte meine Mutter mir einen Besuch in der Arbeitsgemeinschaft „Junge Schriftsetzer“ schmackhaft, und die fand ich schon nicht übel, als ich zum ersten Mal die Druckerei im „Pionierpalast Ernst Thälmann“ in der Berliner Wuhlheide betrat. Der Meister Wolfgang Holtz drückte mir einen Winkelhaken in die Hand und ein Manuskript: ein Gedicht von Rudi Benzien. Auf dem Foto ist der von Buchdruckmeister Wolfgang Holtz korrigierte erste Abzug zu sehen. Die Schrift heißt Super-Grotesk kursiv.
Freizeit sinnvoller ausgestaltet werden könnte als durch die ungesunden Dinge, die 14jährige sonst gern tun. Zuerst wurde ich zum Tischtennisverein geschickt, aber die Turnhalle stank mir zu sehr, war mir zu groß und zu laut. Dann machte meine Mutter mir einen Besuch in der Arbeitsgemeinschaft „Junge Schriftsetzer“ schmackhaft, und die fand ich schon nicht übel, als ich zum ersten Mal die Druckerei im „Pionierpalast Ernst Thälmann“ in der Berliner Wuhlheide betrat. Der Meister Wolfgang Holtz drückte mir einen Winkelhaken in die Hand und ein Manuskript: ein Gedicht von Rudi Benzien. Auf dem Foto ist der von Buchdruckmeister Wolfgang Holtz korrigierte erste Abzug zu sehen. Die Schrift heißt Super-Grotesk kursiv.
Ich habe es später, wenn ich Kinder oder als Lehrbeauftragter Design-Studenten in den Bleisatz einführte, genauso gehalten, denn das Gedicht hat gegenüber allen anderen Texten mehrere Vorteile: Es ist typografisch und somit auch satztechnisch die einfachste Form. Es ist zudem die älteste literarische Form (als Lied). Es lenkt vom Ich ab, weil der Setzer eben nicht seinen eigenen Namen setzt, sondern einen fremden Text, es steht somit auch für die ureigenste Arbeit des Schriftsetzers: der sich in den Dienst eines Textes stellt.
Ich habe später immer wieder bemerkt, daß sich beim Setzen eines Textes im Bleisatz der Text dem Setzer so intensiv darstellt wie in sonst keiner Rezeptionsform, auch nicht im Abschreiben. Beim ersten Gedicht hat man noch nichts davon, aber wenn man später das Setzen automatisiert hat, die Lettern im Setzkasten nicht mehr sucht, sondern auf den sprachlichen Rhythmus kommt und sozusagen „in Blei schreibt“, stellt sich eine eigene Beziehung zum Text her. Das räumliche „Begreifen“ erweitert das gedankliche. Ein Vorzug, von dem nicht nur der Setzer etwas hat. Indem der Schriftsetzer einen Text so intensiv aufnimmt, wird er sich seiner Verantwortung gegen Autor und Leser bewußt.
Jedenfalls wurde mir bei Wolfgang Holtz die Setzerei so recht wunderbar. Sie ist ein riesiger Stabilbaukasten. Es gibt nichts, das man nicht durch Betrachten dem Unklaren entziehen könnte. Alles ist sichtbar, alles ist verständlich, alles paßt zueinander, und wo etwas nicht paßt, kann es durch Umbau passend gemacht werden.
Dieser Stabilbaukasten bietet mehr als ein bißchen perforiertes Blech: Die größten Teile sind aus Gußeisen, man könnte sie als Schlagwaffen mißbrauchen. Die Hauptsache entstammt der Kohlenstoffgruppe: das Schwermetall sechster Periode: Blei. Das Lettern-Metall Blei wird ergänzt mit einem knappen Drittel Antimon, das für die erforderliche Härte verantwortlich ist, sowie 5 bis 6 Prozent Zinn, das die Metalle in der Legierung verbindet und die Abriebfestigkeit erhöht. In manchen Schriftmetallen steckt auch härtendes Kupfer und sind Spuren zu finden von Zink, Arsen, Aluminium, Nickel und Eisen im Promille-Bereich. Die einzelnen Metall-Anteile sind für verschiedene Schriften sowie anderes Setzmaterial verschieden groß. Neben Aluminium, Kupfer und Messing finden wir in der Druckerey auch Neusilber: eine silberweiß glänzende Legierung aus Kupfer, Nickel und Zink. Der Nickelgehalt gibt dieser Legierung ihre besondere Härte. Daraus werden die feinsten Spatien gemacht, sie sind ein Viertel eines typografischen Punktes stark, also 0,094 Millimeter.
Ich habe bis zu meiner Lehre viel Zeit in der Werkstatt von Wolfgang Holtz verbracht. Dort habe ich mühelos gearbeitet, sogar gerechnet, und entwickelte großen Ehrgeiz, während ich der Schule zehn Jahre lang nichts abgewinnen konnte. Die graue, entsetzlich fade und dumme Schulzeit war vorbei, die Lehre begann, und schlagartig, also tatsächlich von einer Woche zu andern, wandelten sich meine Zeugnisse. In der Lehrzeit gab es Berge von Zwischenzeugnissen, alle paar Monate wurde ein Lehrbrief ausgefüllt. Nicht daß meine Eltern arg an mir gezweifelt hatten, aber nun kam ich mit besten Zeugnissen nach Hause, statt als „reserviert“ wurde ich als „freundlich und interessiert“ von meinen Lehrmeistern beschrieben, aus schlechten Schulnoten wurden sehr gute Lehrnoten.
 Hier einige Fotos von Arbeiten, die ich noch gefunden habe: Die Einladung zum ND-Gaststättenwettbewerb würde typografisch in meiner Werkstatt nicht bestehen. Die Versalien sind nicht ausgeglichen, aber der Bindestrich wurde umgedreht und somit höher gestellt, ich hab diesen typografischen Kniff neulich hier beschrieben. Die „Strumpfboutique/Espresso“ fällt ebenfalls durch.
Hier einige Fotos von Arbeiten, die ich noch gefunden habe: Die Einladung zum ND-Gaststättenwettbewerb würde typografisch in meiner Werkstatt nicht bestehen. Die Versalien sind nicht ausgeglichen, aber der Bindestrich wurde umgedreht und somit höher gestellt, ich hab diesen typografischen Kniff neulich hier beschrieben. Die „Strumpfboutique/Espresso“ fällt ebenfalls durch.  Ich muß dazu erklären, daß wir oft Aufträge gesetzt haben, die unserem typografischen Einfluß entzogen waren. Die Manuskripte wurden ausgezeichnet, d.h. es wurde rangeschrieben, was aus welcher Schrift wohin zu setzen war, manchmal gab es eine Skizze, und wir setzten das dann nach. Also ob die Boutique nun Espresso hieß oder man beim Strümpfeprobieren einen Kaffee bekam, das erschließt sich nicht. Auch die halbfette Renaissance-Antiqua paßt nicht und sieht an sich schon klobig aus. Die Räume um die auf Mitte stehenden Punkte sind zu groß. Zwischen KH am Anfang der Zeile fehlt Raum. Die Doppelunterstreichung des Wortes Rechnung ist häßlich und falsch.
Ich muß dazu erklären, daß wir oft Aufträge gesetzt haben, die unserem typografischen Einfluß entzogen waren. Die Manuskripte wurden ausgezeichnet, d.h. es wurde rangeschrieben, was aus welcher Schrift wohin zu setzen war, manchmal gab es eine Skizze, und wir setzten das dann nach. Also ob die Boutique nun Espresso hieß oder man beim Strümpfeprobieren einen Kaffee bekam, das erschließt sich nicht. Auch die halbfette Renaissance-Antiqua paßt nicht und sieht an sich schon klobig aus. Die Räume um die auf Mitte stehenden Punkte sind zu groß. Zwischen KH am Anfang der Zeile fehlt Raum. Die Doppelunterstreichung des Wortes Rechnung ist häßlich und falsch.
 Auf dem Bild mit den Versalzeilen ist eine Übung im Ausgleichen von Versalien zu sehen: Stoßen NN zusammen, ist zwischen ihnen kein Raum. Treffen LA aufeinander, entsteht ein Loch. In NONNE reißt das O mit seinem Binnenraum ein Loch. Solche Unregelmäßigkeiten zu einer, wie es der Typograph Jan Tschichold formuliert hat, „leicht perlenden Zeile“ zu harmonisieren, nennt man Versalienausgleich. Oder auch Neutralisierung. Erst wird ausgeglichen, danach wird leicht gesperrt. Datum auf dem Abzug: 10. November 1983. Tempus fugit.
Auf dem Bild mit den Versalzeilen ist eine Übung im Ausgleichen von Versalien zu sehen: Stoßen NN zusammen, ist zwischen ihnen kein Raum. Treffen LA aufeinander, entsteht ein Loch. In NONNE reißt das O mit seinem Binnenraum ein Loch. Solche Unregelmäßigkeiten zu einer, wie es der Typograph Jan Tschichold formuliert hat, „leicht perlenden Zeile“ zu harmonisieren, nennt man Versalienausgleich. Oder auch Neutralisierung. Erst wird ausgeglichen, danach wird leicht gesperrt. Datum auf dem Abzug: 10. November 1983. Tempus fugit.
 Der Erziehungs- und Bildungsplan für Kinderkrippen liegt mir leider nicht mehr vor, ich habe offenbar nur das Titelblatt gesetzt. Unsere Schule war eine sogenannte Betriebsberufsschule. Sie hieß „Rudi Arndt“ nach einem Berliner Kommunisten und gehörte zur Druckerei „Neues Deutschland“. Hier wurden Schriftsetzer, Buchdrucker, Offsetdrucker, Buchbinder, Chemigrafen ausgebildet und vielleicht auch Tiefdrucker, das weiß ich nicht mehr. Den Auftrag dazu erteilten Stammbetriebe, die die Lehrlinge später übernahmen und mit denen der Lehrvertrag geschlossen war. Mein Lehrherr war “transpress VEB Verlag für Verkehrswesen”, wo ich später als Hersteller arbeitete.
Der Erziehungs- und Bildungsplan für Kinderkrippen liegt mir leider nicht mehr vor, ich habe offenbar nur das Titelblatt gesetzt. Unsere Schule war eine sogenannte Betriebsberufsschule. Sie hieß „Rudi Arndt“ nach einem Berliner Kommunisten und gehörte zur Druckerei „Neues Deutschland“. Hier wurden Schriftsetzer, Buchdrucker, Offsetdrucker, Buchbinder, Chemigrafen ausgebildet und vielleicht auch Tiefdrucker, das weiß ich nicht mehr. Den Auftrag dazu erteilten Stammbetriebe, die die Lehrlinge später übernahmen und mit denen der Lehrvertrag geschlossen war. Mein Lehrherr war “transpress VEB Verlag für Verkehrswesen”, wo ich später als Hersteller arbeitete.  Die Schule war ein großes Haus in Berlin-Mitte unweit der Jannowitzbrücke, ein herrliches altes rotes Backstein-Fabrikgebäude, im Sommer angenehm temperiert, im Winter streikten wir sogar einige Male wegen der Kälte in der Setzerei. Nun ja, und da wurde jedenfalls auch einiges staatliche Zeug gedruckt. Das Foto darunter zeigt eine Tabelle. Tabellensatz brachte manchen zum verzweifeln,
Die Schule war ein großes Haus in Berlin-Mitte unweit der Jannowitzbrücke, ein herrliches altes rotes Backstein-Fabrikgebäude, im Sommer angenehm temperiert, im Winter streikten wir sogar einige Male wegen der Kälte in der Setzerei. Nun ja, und da wurde jedenfalls auch einiges staatliche Zeug gedruckt. Das Foto darunter zeigt eine Tabelle. Tabellensatz brachte manchen zum verzweifeln,  man muß nämlich erst ausrechnen, welche Teile man wie verbaut, und wenn man falsch gerechnet hat und die Tabelle 6p zu breit geworden ist, fängt man von vorne an. Das nächste Foto zeigt ein Stück vom Kopf des „Neuenhagener Echo“. Man kann daran sehen, daß selbst die lokalen Wurstblätter gleichgeschaltet waren und auf dem Titel sozialistische Propaganda publizierten. Aber Metteur war ich sehr gerne, um diese Arbeiten habe ich mich gerissen. Zeitungbauen macht Freude, zumal wenn der Typograf nicht rechnen kann und man dann selbst mit der nötigen Entschlußkraft den Umbruch mal flugs umwirft und erneuert. In Blei! Und unter Zeitdruck, versteht sich.
man muß nämlich erst ausrechnen, welche Teile man wie verbaut, und wenn man falsch gerechnet hat und die Tabelle 6p zu breit geworden ist, fängt man von vorne an. Das nächste Foto zeigt ein Stück vom Kopf des „Neuenhagener Echo“. Man kann daran sehen, daß selbst die lokalen Wurstblätter gleichgeschaltet waren und auf dem Titel sozialistische Propaganda publizierten. Aber Metteur war ich sehr gerne, um diese Arbeiten habe ich mich gerissen. Zeitungbauen macht Freude, zumal wenn der Typograf nicht rechnen kann und man dann selbst mit der nötigen Entschlußkraft den Umbruch mal flugs umwirft und erneuert. In Blei! Und unter Zeitdruck, versteht sich.
Das letzte Bild zeigt ein Stück russischen Text, wir hatten natürlich auch Fremdsprachensatz in der Ausbildung. Das ist ein Korrekturabzug, und was steht darunter? Neulich angekündigt:  Meine persönliche Druckgenehmigungsnummer, die den Verfolgungswahn der Diktatoren in der östlichen Hälfte Deutschlands demonstriert. Die (87) war die Betriebsnummer, RA steht für Rudi Arndt, Nr. 042 war ich, 84 bezeichnet das Jahr 1984, und danach noch einmal der Klarname. Dazu muß ich nichts mehr sagen. Aber zum Satz: Der Text gehörte zu einer archäologischen Fachzeitschrift und war wohl ein Abstract, ich verstehe kein Russisch mehr. Schriftgrad Petit (8 Punkt) und vor allem, jetzt werden alle Schriftsetzer sich lustvoll gruseln: kompreß gesetzt auf eine Breite von 7 Konkordanz, 22 Zeilen hoch. Kompreß heißt ohne Zeilenzwischenraum (im Gegensatz zu splendid). Gewöhnlich sind Zeilen durch Bleischienen, die wir Regletten nennen, voneinander geschieden. Und so habe ich den Text auch gesetzt, aber dann mußten die Regletten ja raus, und wenn dann eine Korrektur auszuführen war …
Meine persönliche Druckgenehmigungsnummer, die den Verfolgungswahn der Diktatoren in der östlichen Hälfte Deutschlands demonstriert. Die (87) war die Betriebsnummer, RA steht für Rudi Arndt, Nr. 042 war ich, 84 bezeichnet das Jahr 1984, und danach noch einmal der Klarname. Dazu muß ich nichts mehr sagen. Aber zum Satz: Der Text gehörte zu einer archäologischen Fachzeitschrift und war wohl ein Abstract, ich verstehe kein Russisch mehr. Schriftgrad Petit (8 Punkt) und vor allem, jetzt werden alle Schriftsetzer sich lustvoll gruseln: kompreß gesetzt auf eine Breite von 7 Konkordanz, 22 Zeilen hoch. Kompreß heißt ohne Zeilenzwischenraum (im Gegensatz zu splendid). Gewöhnlich sind Zeilen durch Bleischienen, die wir Regletten nennen, voneinander geschieden. Und so habe ich den Text auch gesetzt, aber dann mußten die Regletten ja raus, und wenn dann eine Korrektur auszuführen war …
Es gibt den Begriff der Hochzeit für ein doppelt gesetztes Wort. Ein fehlendes Wort heißt Leiche. Aus einem kompreß gesetzten Text in kyrillischer Schrift in Petit eine Hochzeit zu entfernen, ist eine Strafe. Man braucht dafür ruhige Hände und Nerven. Damals versuchte auch ich, mich um diesen Auftrag zu drücken, er kam periodisch und ereilte uns leider alle mal.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [6]





