Die ft-Ligatur ist falsch · 29. Januar 2014
 Jan Tschichold hat an der ft-Ligatur kritisiert, daß sie das kleine »t« zu hoch hinausziehe. Es bekommt in der Ligatur eine Oberlänge, die es nicht hat. Wurde man einmal auf diesen Mißstand aufmerksam, kann man schlecht gezeichnete »t« nicht mehr übersehen. In der Futura mag der Bogen des »ft« noch einen eigenen ornamentalen Reiz entfalten, es ist ein Schnörkel in einer versachlichten Schrift. Aber in der Garamond fällt dieses Schriftzeichen unangenehm auf, hier ist es falsch, die im Kasten liegende ft-Ligatur zu verwenden.
Jan Tschichold hat an der ft-Ligatur kritisiert, daß sie das kleine »t« zu hoch hinausziehe. Es bekommt in der Ligatur eine Oberlänge, die es nicht hat. Wurde man einmal auf diesen Mißstand aufmerksam, kann man schlecht gezeichnete »t« nicht mehr übersehen. In der Futura mag der Bogen des »ft« noch einen eigenen ornamentalen Reiz entfalten, es ist ein Schnörkel in einer versachlichten Schrift. Aber in der Garamond fällt dieses Schriftzeichen unangenehm auf, hier ist es falsch, die im Kasten liegende ft-Ligatur zu verwenden.
Abgebildet auf dem Foto ist die Garamond in Petit, also 8 Punkt, das ist eine recht kleine Schrift. Die Mängel in der Schriftzurichtung, die der Bleisatz naturgemäß hat, sind in der Originalgröße unauffällig.
Hinweisen könnte ich noch darauf, daß die Anwendung der ch-Ligatur in »sch« falsch ist, auch wenn sich Setzer selten darum scherten und scheren. In der Fraktur galt die Regel, daß alle Ligaturen stets gesetzt werden müssen, es gab in Fraktur-Schriften allerdings auch eigene Ligaturen für »ch« und »sch«. In der Antiqua ist die sch-Ligatur mit rundem »s« nicht vorhanden. In dem abgebildeten Wort sieht man vorn ein »sch« aus drei Lettern und hinten das enger stehende ch als Ligatur. Die ch-Ligatur würde das »sch« in »s« und »ch« trennen, deshalb wird sie in »sch« nicht verwendet.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [3]
Charme des Alterns · 7. Oktober 2011
Der Computer mit seinem scharfen Bild auf einem guten Bildschirm und der digitale Schriftsatz und die moderne Drucktechnik haben die Ansprüche an die Qualität von Schriftsatz im Detail so verändert, daß ich mir mitunter in Erinnerung rufen muß, wie selten eine Visitenkarte mit der Lupe betrachtet wird. Natürlich benutzen wir in Buchdruckereien bei der Arbeit mit Bleisatz schon lange Lupen, namentlich Fadenzähler, weil bei diesen Vergrößerungsgeräten der Abstand der Linse zum Anschauungsobjekt fixiert ist und die Durchsicht immer ein scharfes Bild gibt.
Ich habe auf die Rückseite einer Geschäftskarte mehrere Zeilen in der Garamond mager Nonpareille, also 6 Punkt, gesetzt. Nun fallen mir natürlich unter der Lupe die unterschiedlich abgenutzten Lettern auf, aber was da im Einzelnen bröckelt und kleckst, ergibt ohne Lupe ein leicht bewegtes Schriftbild, das sich gut lesen läßt. Als ich allerdings nun dieses Wort “Kunststiftung” vor Augen hatte, war mir der Anblick der ft-Ligatur erstens unbehaglich und erinnerte mich zweitens an die Kritik dieser Ligatur durch Jan Tschichold, der von ihrem Einsatz abriet, weil das “t” gewalttätig zum Kopf des “f” hinaufgezerrt werde.
Nun fallen mir natürlich unter der Lupe die unterschiedlich abgenutzten Lettern auf, aber was da im Einzelnen bröckelt und kleckst, ergibt ohne Lupe ein leicht bewegtes Schriftbild, das sich gut lesen läßt. Als ich allerdings nun dieses Wort “Kunststiftung” vor Augen hatte, war mir der Anblick der ft-Ligatur erstens unbehaglich und erinnerte mich zweitens an die Kritik dieser Ligatur durch Jan Tschichold, der von ihrem Einsatz abriet, weil das “t” gewalttätig zum Kopf des “f” hinaufgezerrt werde.
Außerdem aber bemerkte ich, daß die Zurichtung der Zeile nicht optimal ist. In größeren Graden habe ich dieses Problem bei der Garamond selten bemerkt, sie läuft alles in allem genommen sehr anständig. Man kann eine Bleischrift nicht bis ins Letzte gut zurichten, also die Buchstabenabstände aller möglichen Kombinationen gut angleichen, so daß die Buchseite ein ruhiges Gewebe aus gleichmäßigen Bändern (Zeilen) ergibt. Aber so deutliche Mängel wie in diesem kleinsten Schriftgrad — Halt! Deutliche Mängel? Sie werden doch erst unter der Lupe sichtbar! Und sie werden schon durch fotografische Wiedergabe gemildert! Niemand liest eine Visitenkarte mit dem Fadenzähler! Das mußte ich mir klarmachen. Aber bevor ich mir das verdeutlichte, habe ich die beiden “st” durch ein Viertelpunkt-Spatium getrennt. Ein Viertelpunkt sind 0,093 Millimeter. Darum sind diese Spatien aus Neusilber, weil man nicht einmal Messing so fein herstellen kann.
 Und im Ergebnis war ich wieder unzufrieden, weil es plötzlich aussah wie “Kunst stiftung”. Hier im Foto wieder weniger auffällig als im Original unter der Lupe. Ich hätte nun zwischen “s” und “t” Seidenpapier legen können. Das ist noch feiner als das weniger als ein Zehntelmillimeter starke Neusilberspatium. Aber da hielt ich nun doch inne. Wir haben uns Jahrhunderte nicht um solche Dinge gekümmert, dachte ich mir, und nur, weil ich eben auch an einem großen Bildschirm mit scharfer Darstellung und viertausendfacher Vergrößerung digitale Schriften bearbeite (in kleinen Schriftgraden werden beispielsweise die Trema auf den Umlauten verdickt, wenn von der digitalen Vorlage ein Klischee geätzt werden soll, damit sie nicht wegbrechen), nur weil ich also meine Sehgewohnheiten erweitert habe, werde ich nicht den Bleisatz den Gegebenheiten der Elektronik zu unterwerfen suchen.
Und im Ergebnis war ich wieder unzufrieden, weil es plötzlich aussah wie “Kunst stiftung”. Hier im Foto wieder weniger auffällig als im Original unter der Lupe. Ich hätte nun zwischen “s” und “t” Seidenpapier legen können. Das ist noch feiner als das weniger als ein Zehntelmillimeter starke Neusilberspatium. Aber da hielt ich nun doch inne. Wir haben uns Jahrhunderte nicht um solche Dinge gekümmert, dachte ich mir, und nur, weil ich eben auch an einem großen Bildschirm mit scharfer Darstellung und viertausendfacher Vergrößerung digitale Schriften bearbeite (in kleinen Schriftgraden werden beispielsweise die Trema auf den Umlauten verdickt, wenn von der digitalen Vorlage ein Klischee geätzt werden soll, damit sie nicht wegbrechen), nur weil ich also meine Sehgewohnheiten erweitert habe, werde ich nicht den Bleisatz den Gegebenheiten der Elektronik zu unterwerfen suchen.
Der Bleisatz gibt keine perfekten Bilder, sondern er zeigt Spuren der Abnutzung. Vielbenutzten Lettern schmelzen im Laufe der Jahrzehnte die Serifen weg, die Punzen laufen ein wenig zu, die Kanten werden weich, aber eben dieses nicht berechenbare Bild macht den Charme der Handsatzschrift aus. Sie gleicht uns, wenn sie Spuren zeigt, so wie wir Falten kriegen und uns die Zähne ausfallen und das Haar dünner wird. Deshalb kommt uns Bleisatz warm vor wie alles, in dem sich Vergänglichkeit zeigt. Digitale Schriften altern nicht. Sie wirken immer etwas steif, da kann sich der Zeichner noch so viel Mühe geben. Selbst wenn er Abnutzungserscheinungen im Schriftenprogramm installiert, wird die Schrift den Charme des Handgemachten nicht erreichen.
So habe ich also die Zeile ohne Ausgleich gedruckt, und die ft-Ligatur entfernt.
Ich gebe noch zu bedenken, daß für jede winzige Korrektur die eiserne Schließform mit dem Bleisatz aus der Maschine gehoben und zur Schließplatte getragen wird. Kurze Reinigung von der Druckfarbe, dann wird die Form an zwei Schließzeugen mit dem Schlüssel geöffnet, die Korrektur ausgeführt, die Form leicht geschlossen, mit dem Klopfholz werden die Typen auf eine Höhe gebracht, die Form wird ganz geschlossen, wieder in die Maschine gehoben, und dann erfolgt ein neuer Andruck. Diese Arbeit des Einrichtens dauert ohnehin ein Weilchen, aber wer dann noch Minuskeln einer Nonpareille-Zeile ausgleichen will, muß mit dem Klammerbeutel gepudert sein.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [1]
Viele Schriften auf einer Seite · 24. Mai 2010
 Es sind zwar nur zwei halbe Texte, das ist keine Doppelseite, sondern ein Druckbogen mit den Seiten 26 (links) und 7 (rechts), aber so große Textpassagen kann ich nicht scharf zeigen. Zum dunklen Rötlichblau kommt im nächsten Druckgang noch Orange. Aber über einige Details darf ich schon plaudern, zumal sie nichts mit dem Textinhalt zu tun haben, sondern mit seiner Form.
Es sind zwar nur zwei halbe Texte, das ist keine Doppelseite, sondern ein Druckbogen mit den Seiten 26 (links) und 7 (rechts), aber so große Textpassagen kann ich nicht scharf zeigen. Zum dunklen Rötlichblau kommt im nächsten Druckgang noch Orange. Aber über einige Details darf ich schon plaudern, zumal sie nichts mit dem Textinhalt zu tun haben, sondern mit seiner Form.
 Apropos Form, dies hier ist die Druckform im Schließrahmen. Das Buch wird komplett vom Bleisatz gedruckt, Klischees kommen nicht zur Anwendung. Ausschließlich Handsatzqualität. Damit läßt sich einiges anrichten. Neulich las ich (Dank nach Hamburg für den Tip!) ein Interview mit Kurt Weidemann in den Heidelberg Nachrichten (Ausgabe 269, Seite 48ff., online hier)
Apropos Form, dies hier ist die Druckform im Schließrahmen. Das Buch wird komplett vom Bleisatz gedruckt, Klischees kommen nicht zur Anwendung. Ausschließlich Handsatzqualität. Damit läßt sich einiges anrichten. Neulich las ich (Dank nach Hamburg für den Tip!) ein Interview mit Kurt Weidemann in den Heidelberg Nachrichten (Ausgabe 269, Seite 48ff., online hier)
Darin sagt er, es wäre ihm “am liebsten, wenn wieder der manuelle Bleisatz gemacht würde, weil ich jeden Buchstaben einzeln aus dem Setzkasten holen muss, also zur Gründlichkeit gezwungen bin. Ich habe das Produkt in die Hand genommen und in den Winkelhaken hineingestellt. Ich habe die Zeile spiegelbildlich über Kopf gesehen, die Zeile überflogen, ausgeglichen und mich dann an die nächste Zeile gemacht. In dem Moment, wo ich die Buchstaben spiegelbildlich über Kopf sehe, lerne ich, Formen zu unterscheiden und Qualitäten zu erkennen.” Übrigens erklärt das auch die Fotos vom Bleisatz in diesem Blog, die ich so zeige, wie ich den Satz sehe, also kopfgestellt, damit man von links nach rechts lesen kann.
Weidemann sagt, finde ich, vieles schön und richtig, aber manchmal übertreibt er. Auf die Frage nach typografischen Innovationen antwortet Weidemann: “Für die Typografie sehe ich nur einen geringen Innovationsspielraum, einen äußerst geringen. Da kann man nur etwas fortsetzen, was in 450 Jahren gewachsen ist. Wir brauchen kein einziges neues Alphabet mehr, und ich kenne gute Typografen, die ihr Leben lang mit drei Schriften ausgekommen sind. Heute gibt es 30 000 Schriften auf dem Markt. Davon sind 29 984 überflüssig. Die kann man im Stillen Ozean versenken, ohne einen kulturellen Flurschaden anzurichten. Da geht nichts Wertvolles kaputt.” Sechzehn Schriften will er uns noch gönnen, wobei der einzelne Typograf sich mit einer Handvoll bescheiden soll. Möglicherweise übertreibt er aus pädagogischen Gründen, aber mir ist die Wahrheit lieber als die Erziehung. Der Fundus an Meisterschriften ist seit Jahrhunderten größer als das, was Weidemann uns läßt; und ein Typograf, der mit drei Schriften auskommt, also nicht einmal zwischen zwei Schriften gleichen Stils wählen darf, welche Schriftart hat der denn über Bord geworfen? Renaissance-Antiqua, Übergangs-Antiqua, Klassizistische, Serifenlose, Gotische, Rundgotische, Schwabacher, Fraktur? Von Schreib- und Schmuckschriften nicht zu reden.
 So, jetzt ein bißchen Schlamm und Schmutz, denn ich bin kein Bibeltypograf, der sein Lebtag mit drei Schriften auskommen kann. (Es ist ein Andruck auf dem Foto, deshalb so unsauber.) Im Bilde hier die halbfette Fundamental kursiv (Gießerei Ludwig Wagner, Leipzig, Erstguß 1939, Entwurf Arno Drescher), die Bigband (Entwurf Karlgeorg Hoefer, Gießerei Ludwig & Mayer, Frankfurt am Main, Erstguß 1974) und die halbfette Block-Signal (Entwurf Walter Wege für die H. Berthold AG, Erstguß Berlin 1932). Auf der Doppelseite im Buch tummeln sich dann außerdem noch die schmalhalbfette Futura und die kursive Garamond und als Grundschrift die magere Maxima (Gießerei Typoart, Entwurf von Gert Wunderlich, 1960er Jahre, Erstguß 1970?, stimmt das?).
So, jetzt ein bißchen Schlamm und Schmutz, denn ich bin kein Bibeltypograf, der sein Lebtag mit drei Schriften auskommen kann. (Es ist ein Andruck auf dem Foto, deshalb so unsauber.) Im Bilde hier die halbfette Fundamental kursiv (Gießerei Ludwig Wagner, Leipzig, Erstguß 1939, Entwurf Arno Drescher), die Bigband (Entwurf Karlgeorg Hoefer, Gießerei Ludwig & Mayer, Frankfurt am Main, Erstguß 1974) und die halbfette Block-Signal (Entwurf Walter Wege für die H. Berthold AG, Erstguß Berlin 1932). Auf der Doppelseite im Buch tummeln sich dann außerdem noch die schmalhalbfette Futura und die kursive Garamond und als Grundschrift die magere Maxima (Gießerei Typoart, Entwurf von Gert Wunderlich, 1960er Jahre, Erstguß 1970?, stimmt das?).
 Aber die Doppelseite wird trotzdem anständig aussehen, auch wenn sechs Schriften auf ihr beisammen sind. Hier zwei davon, die Futura unten und die Garamond oben. Zweitfarbe fehlt noch. Es handelt sich um ein Platten-Cover, also gewissermaßen um ein typografisches Zitat im Text.
Aber die Doppelseite wird trotzdem anständig aussehen, auch wenn sechs Schriften auf ihr beisammen sind. Hier zwei davon, die Futura unten und die Garamond oben. Zweitfarbe fehlt noch. Es handelt sich um ein Platten-Cover, also gewissermaßen um ein typografisches Zitat im Text.
 Hier zeige ich die Satzform; die Garamond mußte um den Kreis, der auf einen eckigen Kegel gegossen ist, herumgebaut werden. War aber keine große Sache.
Hier zeige ich die Satzform; die Garamond mußte um den Kreis, der auf einen eckigen Kegel gegossen ist, herumgebaut werden. War aber keine große Sache.
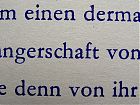 Die Garamond hat eine ft-Ligatur. Ich habe vergessen, sie zu fotografieren. In der Ligatur ist das t nach oben gezogen, um in den Kopf des f überzugehen. Jan Tschichold hat diese Vergewaltigung des t scharf kritisiert. Ich hatte es erst gesetzt, aber als ich dann die ersten Andrucke sah, habe ich diese Ligatur doch wieder aufgelöst. Wenn man es einmal mit Tschicholds Augen gesehen hat, kann man das ft kaum noch verwenden. Vielleicht in einer kleinen Schrift auf einer Akzidenz, aber für Buchkunst ist die Ligatur zu häßlich. Möglicherweise wollte Thannhaeuser sie gar nicht zeichnen (Erstguß 1955), und die Genossen von Typoart haben ihn überredet.
Die Garamond hat eine ft-Ligatur. Ich habe vergessen, sie zu fotografieren. In der Ligatur ist das t nach oben gezogen, um in den Kopf des f überzugehen. Jan Tschichold hat diese Vergewaltigung des t scharf kritisiert. Ich hatte es erst gesetzt, aber als ich dann die ersten Andrucke sah, habe ich diese Ligatur doch wieder aufgelöst. Wenn man es einmal mit Tschicholds Augen gesehen hat, kann man das ft kaum noch verwenden. Vielleicht in einer kleinen Schrift auf einer Akzidenz, aber für Buchkunst ist die Ligatur zu häßlich. Möglicherweise wollte Thannhaeuser sie gar nicht zeichnen (Erstguß 1955), und die Genossen von Typoart haben ihn überredet.
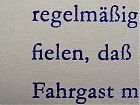 Die fi-Ligatur ist ja sehr schön.
Die fi-Ligatur ist ja sehr schön.
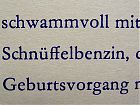 Auch die ff-Ligatur kann sich sehen lassen.
Auch die ff-Ligatur kann sich sehen lassen.
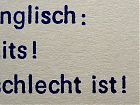 In der Schriftgießerei hat man so einiges ausgeheckt. Zum Beispiel für die Maxima. Hier kam man auf die Idee, an Ruf- und Fragezeichen, ans Kolon und Semikolon das Spatium, das der Setzer von Hand vor das Zeichen setzt, gleich anzugießen, um dem Setzer einen Handgriff zu ersparen. Der arme Setzer hat aber nicht nur aus der Maxima zu setzen (außer er arbeitet für einen Typografen wie den Bekannten Weidemanns), und so muß er für einen gewohnten Handgriff (Punkt-Spatium vor !?;: und Guillemets in Brotschriftgraden) plötzlich darüber nachdenken, in welchem Kasten er die Finger hat.
In der Schriftgießerei hat man so einiges ausgeheckt. Zum Beispiel für die Maxima. Hier kam man auf die Idee, an Ruf- und Fragezeichen, ans Kolon und Semikolon das Spatium, das der Setzer von Hand vor das Zeichen setzt, gleich anzugießen, um dem Setzer einen Handgriff zu ersparen. Der arme Setzer hat aber nicht nur aus der Maxima zu setzen (außer er arbeitet für einen Typografen wie den Bekannten Weidemanns), und so muß er für einen gewohnten Handgriff (Punkt-Spatium vor !?;: und Guillemets in Brotschriftgraden) plötzlich darüber nachdenken, in welchem Kasten er die Finger hat.
 Der Satz: an die Ausrufezeichen muß kein Spatium mehr gelegt werden.
Der Satz: an die Ausrufezeichen muß kein Spatium mehr gelegt werden.
Um den Freunden der Werke Max Goldts den Mund wässrig zu machen auf dieses Buch, verrate ich die Überschriften der beiden Texte. Der erste heißt Chcocklers Flops, der zweite Die Elfjährige, die in der Achterbahn ein Kind ohne Knochen gebar. Bestellen kann man das Buch noch nicht, es ist einfach zu früh, mitten in der Produktion.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [1]
Ligatur ja — Ligatur nein · 24. Oktober 2008
 Gestern druckte ich eine Visitenkarte vom Bleisatz für einen Menschen mit Namen Schache… (aus Diskretion sind hier in der Regel kein Auftragsarbeiten zu sehen, in den Fotos wurde der Rest des Namens retuschiert), in der mich das Sch störte, weil die Zurichtung von S und ch-Ligatur den Zischlaut zu trennen scheint. Grundsätzlich gilt als
Gestern druckte ich eine Visitenkarte vom Bleisatz für einen Menschen mit Namen Schache… (aus Diskretion sind hier in der Regel kein Auftragsarbeiten zu sehen, in den Fotos wurde der Rest des Namens retuschiert), in der mich das Sch störte, weil die Zurichtung von S und ch-Ligatur den Zischlaut zu trennen scheint. Grundsätzlich gilt als  Regel, daß Ligaturen immer zu setzen sind, wenn die Wortkonstruktion es ermöglicht, also nicht über Wortfugen hinweg. In dem Wort Auflage beispielsweise wird keine fl-Ligatur verwendet. Aber es gibt auch typografische Anlässe, die Ligatur zu vermeiden. Im ersten Foto ist das Sch mit ch zu sehen, im zweiten habe ich c und h getrennt, damit sich ein gleichmäßiges Sch ergibt. Das zweite ch als eigener
Regel, daß Ligaturen immer zu setzen sind, wenn die Wortkonstruktion es ermöglicht, also nicht über Wortfugen hinweg. In dem Wort Auflage beispielsweise wird keine fl-Ligatur verwendet. Aber es gibt auch typografische Anlässe, die Ligatur zu vermeiden. Im ersten Foto ist das Sch mit ch zu sehen, im zweiten habe ich c und h getrennt, damit sich ein gleichmäßiges Sch ergibt. Das zweite ch als eigener  Laut wurde ligiert belassen. Das Bleisatzfoto zeigt den korrigierten Satz. Schrift: Garamond kursiv (Typoart). Originalgröße der Schrift: 16p (Schriftgrad Tertia).
Laut wurde ligiert belassen. Das Bleisatzfoto zeigt den korrigierten Satz. Schrift: Garamond kursiv (Typoart). Originalgröße der Schrift: 16p (Schriftgrad Tertia).
— Martin Z. Schröder
Kommentare [9]
Wozu Ligaturen? · 17. Februar 2008
 Mit dem ersten Foto beurkunde ich schwarz auf weiß mein Gefühl gegen die Kommentatoren dieses Mediums. Der Satz wurde gefügt aus der lichten Futura und Meister-Ornamenten. Ich habe das bislang nur angedruckt, irgendwann möchte ich mal eine prunkvolle mehrfarbige Karte damit herstellen. So als Visitenkarte (das ist die wirkliche Größe des fotografierten Objektes) macht sich das Danken aber auch nicht schlecht. Man würde sich viel Gerede sparen, wenn man einfach eine überschwenglich ausstaffierte Visitenkarte überreichte. Über die Offerte eines so praktischen Gebrauchsgegenstandes werde ich mal nachdenken.
Mit dem ersten Foto beurkunde ich schwarz auf weiß mein Gefühl gegen die Kommentatoren dieses Mediums. Der Satz wurde gefügt aus der lichten Futura und Meister-Ornamenten. Ich habe das bislang nur angedruckt, irgendwann möchte ich mal eine prunkvolle mehrfarbige Karte damit herstellen. So als Visitenkarte (das ist die wirkliche Größe des fotografierten Objektes) macht sich das Danken aber auch nicht schlecht. Man würde sich viel Gerede sparen, wenn man einfach eine überschwenglich ausstaffierte Visitenkarte überreichte. Über die Offerte eines so praktischen Gebrauchsgegenstandes werde ich mal nachdenken.
 Das zweite Foto bildet einen Nachtrag zum vorhergehenden Eintrag und den Kommentaren und zeigt ein Stück Satz aus der Pracht-Antiqua. Ist das Komma nach „tzen“, im Bild oben (für Schriftsetzer: unten) ein Zwiebelfisch? Könnte gut sein, die beiden sehen sehr unterschiedlich aus. Das andere Komma auf dem Wort ist korrekt. Ich muß die Letter anschauen, um es mit Sicherheit sagen zu können. Außerdem auf diesem Foto zu sehen: Vor dem Ausrufezeichen liegt womöglich etwas zu viel Raum, aber weniger als danach. Satztechnisch richtig, mikrotypografisch gesehen hätte ich den Raum halbieren sollen. Das Foto zeigt die starke Vergrößerung der Schriftgrades Petit (8p). Spätestens wenn ich den Satz ablege, wird mir einfallen, daß ich hier etwas nachzutragen habe.
Das zweite Foto bildet einen Nachtrag zum vorhergehenden Eintrag und den Kommentaren und zeigt ein Stück Satz aus der Pracht-Antiqua. Ist das Komma nach „tzen“, im Bild oben (für Schriftsetzer: unten) ein Zwiebelfisch? Könnte gut sein, die beiden sehen sehr unterschiedlich aus. Das andere Komma auf dem Wort ist korrekt. Ich muß die Letter anschauen, um es mit Sicherheit sagen zu können. Außerdem auf diesem Foto zu sehen: Vor dem Ausrufezeichen liegt womöglich etwas zu viel Raum, aber weniger als danach. Satztechnisch richtig, mikrotypografisch gesehen hätte ich den Raum halbieren sollen. Das Foto zeigt die starke Vergrößerung der Schriftgrades Petit (8p). Spätestens wenn ich den Satz ablege, wird mir einfallen, daß ich hier etwas nachzutragen habe.
 Ein Kommentar brachte mich auf den Gedanken, longe et late auszubreiten, was ich über Ligaturen weiß. Die mittlerweile nicht mehr wenigen Experten unter den Lesern dieses Magazins mögen den Text überspringen, aber wenn sie ihn doch aufnehmen und dann etwas ergänzen oder anders darstellen möchten, mögen sie sich bitte nicht zurückhalten.
Ein Kommentar brachte mich auf den Gedanken, longe et late auszubreiten, was ich über Ligaturen weiß. Die mittlerweile nicht mehr wenigen Experten unter den Lesern dieses Magazins mögen den Text überspringen, aber wenn sie ihn doch aufnehmen und dann etwas ergänzen oder anders darstellen möchten, mögen sie sich bitte nicht zurückhalten.
 Eine Ligatur ist eine Buchstabenverbindung. Den Begriff „legato“ kennen alle, die nach Noten musizieren und dabei Töne verbinden, im Gegensatz zu portato und staccato. Erfinden mußte die Ligatur niemand, kalligrafisch ergibt sie sich aus der fließenden Bewegung, so kam sie aus der Handschrift in den Holzstich, denn man ahmte die Handschrift nach, welche sonst hätte man nachahmen sollen? Für den Druck mit bleiernen Lettern hat sie aber doch jemand erfunden, das mußte ja technisch
Eine Ligatur ist eine Buchstabenverbindung. Den Begriff „legato“ kennen alle, die nach Noten musizieren und dabei Töne verbinden, im Gegensatz zu portato und staccato. Erfinden mußte die Ligatur niemand, kalligrafisch ergibt sie sich aus der fließenden Bewegung, so kam sie aus der Handschrift in den Holzstich, denn man ahmte die Handschrift nach, welche sonst hätte man nachahmen sollen? Für den Druck mit bleiernen Lettern hat sie aber doch jemand erfunden, das mußte ja technisch  entwickelt werden. Wer war’s? Johannes Gutenberg. Der hat eigentlich alles gleich auf einmal erfunden, worauf es heute noch ankommt. Ob grobe oder feine typografische Fragen, er hat sie sich gestellt und sie mustergültig beantwortet. Da es ihm vorrangig nicht um eine billige Produktion von Büchern ging, sondern typografisch vor allem um die Schaffung einer schöneren und gleichmäßiger „geschriebenen“ Bibel, der wichtigsten Schrift seiner Zeit, als die Mönche in den klösterlichen Schreibstuben zu erschaffen vermochten, hat er nicht nur die Buchstaben des Alphabets einzeln entworfen und als Lettern gegossen, sondern dazu dieselben Buchstaben in verschieden breiten Ausführungen sowie außerdem Abkürzungen und tatsächlich über siebzig (70)
entwickelt werden. Wer war’s? Johannes Gutenberg. Der hat eigentlich alles gleich auf einmal erfunden, worauf es heute noch ankommt. Ob grobe oder feine typografische Fragen, er hat sie sich gestellt und sie mustergültig beantwortet. Da es ihm vorrangig nicht um eine billige Produktion von Büchern ging, sondern typografisch vor allem um die Schaffung einer schöneren und gleichmäßiger „geschriebenen“ Bibel, der wichtigsten Schrift seiner Zeit, als die Mönche in den klösterlichen Schreibstuben zu erschaffen vermochten, hat er nicht nur die Buchstaben des Alphabets einzeln entworfen und als Lettern gegossen, sondern dazu dieselben Buchstaben in verschieden breiten Ausführungen sowie außerdem Abkürzungen und tatsächlich über siebzig (70)  Ligaturen angefertigt. Warum? Die Form der Spalten mit geraden Kanten hat er nicht erschaffen durch die Veränderungen der Wortzwischenräume, sondern durch Austauschen von Buchstaben und Einsatz von Ligaturen. (Übrigens hat Gutenberg auch den satztechnischen Randausgleich „erfunden“ und die Satzkanten optisch begradigt, indem er Satzzeichen, namentlich Punkt, Komma, Divis, aus der Satzkante hinauszog, ebenso wurden links einige wenige Versalien aus der geometrischen Geraden herausgestellt, die großen illuminierten Initialen wurden von den Buchmalern ohnehin entsprechend eingepaßt.) Wer es sich ansehen möchte, findet im Internet die Göttinger B42 (so wird die 42zeilige Gutenberg-Bibel genannt, weil eine Spalte aus entsprechend vielen Zeilen besteht und um sie von der B36 zu unterscheiden) vollständig fotografiert und digitalisiert hier. Das Göttinger Exemplar ist eines der vier vorhandenen vollständigen (!) auf Pergament gedruckten. Die anderen drei liegen in London, Paris und Washington. Unvollständige sind auch anderswo vorhanden. In Mainz ist keine, nein, in Mainz nicht. Tut mir leid, Gutenbergstadt Mainz, daß ich auf diese demütigende Wirklichkeit hinweisen muß. Göttingen! In Mainz liegen zwei auf Papier gedruckte, deren Illuminationen an das Göttinger Exemplar nicht heranreichen. Leider. Digital gibt’s in Mainz auch nichts von Interesse, nur Filme ohne Ton vom Kaffeetrinken im Büro. Und eine so unbeholfene, uncharmante und öde Website ohne Informationswert wie die über Gutenberg aus Mainz vom Gutenbergmuseum, das den Mann immer noch mit einem langen Bart ausstellt (als Patrizier wird er kaum einen gehabt haben), möchte ich nicht empfehlen. Mainz ist nichts für Gutenberg. Genug also von Mainz. Abgesehen von Stephan Füssel natürlich! Über dessen Buch “Gutenberg und seine Wirkung” könnte viel Gutes gesagt werden.
Ligaturen angefertigt. Warum? Die Form der Spalten mit geraden Kanten hat er nicht erschaffen durch die Veränderungen der Wortzwischenräume, sondern durch Austauschen von Buchstaben und Einsatz von Ligaturen. (Übrigens hat Gutenberg auch den satztechnischen Randausgleich „erfunden“ und die Satzkanten optisch begradigt, indem er Satzzeichen, namentlich Punkt, Komma, Divis, aus der Satzkante hinauszog, ebenso wurden links einige wenige Versalien aus der geometrischen Geraden herausgestellt, die großen illuminierten Initialen wurden von den Buchmalern ohnehin entsprechend eingepaßt.) Wer es sich ansehen möchte, findet im Internet die Göttinger B42 (so wird die 42zeilige Gutenberg-Bibel genannt, weil eine Spalte aus entsprechend vielen Zeilen besteht und um sie von der B36 zu unterscheiden) vollständig fotografiert und digitalisiert hier. Das Göttinger Exemplar ist eines der vier vorhandenen vollständigen (!) auf Pergament gedruckten. Die anderen drei liegen in London, Paris und Washington. Unvollständige sind auch anderswo vorhanden. In Mainz ist keine, nein, in Mainz nicht. Tut mir leid, Gutenbergstadt Mainz, daß ich auf diese demütigende Wirklichkeit hinweisen muß. Göttingen! In Mainz liegen zwei auf Papier gedruckte, deren Illuminationen an das Göttinger Exemplar nicht heranreichen. Leider. Digital gibt’s in Mainz auch nichts von Interesse, nur Filme ohne Ton vom Kaffeetrinken im Büro. Und eine so unbeholfene, uncharmante und öde Website ohne Informationswert wie die über Gutenberg aus Mainz vom Gutenbergmuseum, das den Mann immer noch mit einem langen Bart ausstellt (als Patrizier wird er kaum einen gehabt haben), möchte ich nicht empfehlen. Mainz ist nichts für Gutenberg. Genug also von Mainz. Abgesehen von Stephan Füssel natürlich! Über dessen Buch “Gutenberg und seine Wirkung” könnte viel Gutes gesagt werden.
 Erhalten haben sich Ligaturen im Bleisatz aus technischen Gründen, wie das „Handbuch für Schriftsetzer“ von Friedrich Bauer (1. Auflage, Klimsch & Co., Frankfurt am Main, 1904) erklärt. Die Gemeinen (Kleinbuchstaben) f und langes s „sind in den meisten, namentlich älteren Schnitten mit kleinen Überhängen versehen, die gegen ein folgendes f, i, l, s [gemeint ist das lange s] oder t stoßen und entweder abbrechen oder wenn sie zur Verhütung des Abbrechens durch ein Spatium getrennt würden, eine unschöne und unberechtigte Lücke verursachen. Deshalb werden die Buchstaben seit alten Zeiten vom Schriftgießer zusammengegossen geliefert und der Setzer hat darauf zu achten, daß diese Ligaturen in allen Fällen, wo sie am Platze sind, auch angewendet werden.“ In der 8., neubearbeiteten Ausgabe aus dem Jahr 1934 wird ergänzend erklärt, daß die Ligaturen ch, ck, st (langes s), ß, und tz in der Fraktur als selbständige Buchstaben zu behandeln sind, sofern sie in einer Silbe vorkommen und auch im spationierten (gesperrten) Satz nicht getrennt werden dürfen. Neben der Silbentrennung (bspw. ent-zwei) werden Ausnahmen genannt wie diese: „Das ck ist nur in polnischen Namen z.B. Pawlecki, getrennt zu setzen, weil es hier kein doppeltes k ist, sondern wie tz-k ausgesprochen wird.“ (Was mich an die nach dem berühmten Kupferstecher Daniel Nikolaus Chodowiecki benannte Straße in Berlin-Prenzlauer Berg erinnert, die von Einheimischen gerne „Schodowikistraße“ genannt wird und nicht „Chodowiëtzki“.)
Erhalten haben sich Ligaturen im Bleisatz aus technischen Gründen, wie das „Handbuch für Schriftsetzer“ von Friedrich Bauer (1. Auflage, Klimsch & Co., Frankfurt am Main, 1904) erklärt. Die Gemeinen (Kleinbuchstaben) f und langes s „sind in den meisten, namentlich älteren Schnitten mit kleinen Überhängen versehen, die gegen ein folgendes f, i, l, s [gemeint ist das lange s] oder t stoßen und entweder abbrechen oder wenn sie zur Verhütung des Abbrechens durch ein Spatium getrennt würden, eine unschöne und unberechtigte Lücke verursachen. Deshalb werden die Buchstaben seit alten Zeiten vom Schriftgießer zusammengegossen geliefert und der Setzer hat darauf zu achten, daß diese Ligaturen in allen Fällen, wo sie am Platze sind, auch angewendet werden.“ In der 8., neubearbeiteten Ausgabe aus dem Jahr 1934 wird ergänzend erklärt, daß die Ligaturen ch, ck, st (langes s), ß, und tz in der Fraktur als selbständige Buchstaben zu behandeln sind, sofern sie in einer Silbe vorkommen und auch im spationierten (gesperrten) Satz nicht getrennt werden dürfen. Neben der Silbentrennung (bspw. ent-zwei) werden Ausnahmen genannt wie diese: „Das ck ist nur in polnischen Namen z.B. Pawlecki, getrennt zu setzen, weil es hier kein doppeltes k ist, sondern wie tz-k ausgesprochen wird.“ (Was mich an die nach dem berühmten Kupferstecher Daniel Nikolaus Chodowiecki benannte Straße in Berlin-Prenzlauer Berg erinnert, die von Einheimischen gerne „Schodowikistraße“ genannt wird und nicht „Chodowiëtzki“.)
In den gebrochenen Schriften, vornehmlich der Fraktur, sind durch das lange s deutlich mehr Ligaturen gebräuchlich, nämlich ch, ck, ff, fi, fl, ft, ll, si, ss, st, sch, ß, tz. In der Antiqua sind die s- und f-Ligaturen gebräuchlich, dazu das et-Zeichen & für „und“, welches im deutschen Satz nur  in Gesellschaftsfirmen eingesetzt wird, später kamen ch, ck und tz hinzu, wobei das ch in sch nicht angewendet werden sollte. Die ft-Ligatur in der Antiqua nannte der Typograf Jan Tschichold falsch (oder gar dumm?, müßt ich suchen), weil das t in der Antiqua nicht so hoch strebt, als daß es sinnvoll wäre, es mit dem f zu verbinden. Es gibt indes einige Ligaturen, die auf die Verbindung des Kopfes vom f mit dem folgenden i, l oder t oder auf durchgezogene Querstriche verzichten, beispielsweise in der Walbaum. Im Satzbild ist hier die Ligatur fast nicht zu erkennen, die Buchstaben stehen nur ganz gering enger beieinander.
in Gesellschaftsfirmen eingesetzt wird, später kamen ch, ck und tz hinzu, wobei das ch in sch nicht angewendet werden sollte. Die ft-Ligatur in der Antiqua nannte der Typograf Jan Tschichold falsch (oder gar dumm?, müßt ich suchen), weil das t in der Antiqua nicht so hoch strebt, als daß es sinnvoll wäre, es mit dem f zu verbinden. Es gibt indes einige Ligaturen, die auf die Verbindung des Kopfes vom f mit dem folgenden i, l oder t oder auf durchgezogene Querstriche verzichten, beispielsweise in der Walbaum. Im Satzbild ist hier die Ligatur fast nicht zu erkennen, die Buchstaben stehen nur ganz gering enger beieinander.
Für die großen Grade der kursiven Garamond der Schriftgießerei Typoart, die hier auf den Fotos gezeigt wird, hat Herbert Thannhaeuser weitere Ligaturen gezeichnet, von denen hier nur eine Auswahl gezeigt wird. Das hat keine satztechnischen, sondern nur noch ästhetische Gründe.  So große Schriftgrade müssen allerdings fast immer von Hand ausgeglichen werden, so daß der Einsatz der Ligaturen zu sehr ungünstigen Ergebnissen führen kann, weil man die Schrift insgesamt weiter laufen lassen muß, sofern eine mit mehr Fleisch (so nennt man die nichtdruckenden Flächen der Letter um das Schriftbild herum) zugerichtete Buchstabenverbindung dies erzwingt.
So große Schriftgrade müssen allerdings fast immer von Hand ausgeglichen werden, so daß der Einsatz der Ligaturen zu sehr ungünstigen Ergebnissen führen kann, weil man die Schrift insgesamt weiter laufen lassen muß, sofern eine mit mehr Fleisch (so nennt man die nichtdruckenden Flächen der Letter um das Schriftbild herum) zugerichtete Buchstabenverbindung dies erzwingt.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [6]
Englische Schreibschrift · 29. Oktober 2007
 Heute habe ich eine Einladung zur Trauung gedruckt. Meine Kunden kamen zum Andruck, weil ihnen die Farbe wichtig war, die ich manchmal von Hand mische. Für den heute benötigten Sepia-Ton verwendete ich ein bläuliches, also kaltes Rot, auch als Weinrot geläufig, das ich mit Hellbraun anwärmte und mit Dunkelbraun abtönte.
Heute habe ich eine Einladung zur Trauung gedruckt. Meine Kunden kamen zum Andruck, weil ihnen die Farbe wichtig war, die ich manchmal von Hand mische. Für den heute benötigten Sepia-Ton verwendete ich ein bläuliches, also kaltes Rot, auch als Weinrot geläufig, das ich mit Hellbraun anwärmte und mit Dunkelbraun abtönte.
 Für den Satz habe ich die Excelsior verwendet, eine Englische Schreibschrift, die ich in der Bauerschen Gießerei in Barcelona gekauft habe. D.h. ursprünglich habe ich die mal in den 1990er Jahren von der Gießerei Wagner in Ingolstadt gekauft, die sich die Matrizen aus Barcelona ausgeliehen hatte. Jahre später gab es die Gießerei nicht mehr.
Für den Satz habe ich die Excelsior verwendet, eine Englische Schreibschrift, die ich in der Bauerschen Gießerei in Barcelona gekauft habe. D.h. ursprünglich habe ich die mal in den 1990er Jahren von der Gießerei Wagner in Ingolstadt gekauft, die sich die Matrizen aus Barcelona ausgeliehen hatte. Jahre später gab es die Gießerei nicht mehr.  2006 habe ich Kontakt nach Barcelona geknüpft, wo die Bauersche Gießerei schon früher eine von zwei spanischen Filialen hatte, die jetzt als einzige europäische Gießerei außer der Firma Stempel übriggeblieben ist. Gießerei für Handsatzschriften wohlgemerkt, es gibt noch Spezialbetriebe für andere Arten von Satzmaterial, aber das würde hier wieder zu sehr ins Detail führen.
2006 habe ich Kontakt nach Barcelona geknüpft, wo die Bauersche Gießerei schon früher eine von zwei spanischen Filialen hatte, die jetzt als einzige europäische Gießerei außer der Firma Stempel übriggeblieben ist. Gießerei für Handsatzschriften wohlgemerkt, es gibt noch Spezialbetriebe für andere Arten von Satzmaterial, aber das würde hier wieder zu sehr ins Detail führen.
 Englische Schreibschrift ist eine spaßige Angelegenheit, dafür braucht man ein bißchen Erfahrung. Diverse Buchstaben gibt es in zwei Varianten, einmal innerhalb eines Wortes einzusetzen, einmal am Ende: r und Schluß-r, t und Schluß-t, auch zwei e, zwei s, dazu Ligaturen (Buchstabenverbindungen) von ch, ck, ff, fi, fl sowie beispielsweise in der Excelsior zwei verschiedene Versalien T.
Englische Schreibschrift ist eine spaßige Angelegenheit, dafür braucht man ein bißchen Erfahrung. Diverse Buchstaben gibt es in zwei Varianten, einmal innerhalb eines Wortes einzusetzen, einmal am Ende: r und Schluß-r, t und Schluß-t, auch zwei e, zwei s, dazu Ligaturen (Buchstabenverbindungen) von ch, ck, ff, fi, fl sowie beispielsweise in der Excelsior zwei verschiedene Versalien T.  Der Setzer muß das alles während des Setzens bedenken, er muß das Druckbild vor Augen haben und wissen, daß er ein Schluß-r zwar gewöhnlich ans Wortende setzt, aber nicht vor ein Satzzeichen wie den Punkt oder das Komma, weil sonst ein unschönes Loch entstünde. Er muß auch wissen, daß es zwei z gibt: eines mit Unterlänge, eines ohne; und planvoll ist das jeweilige für ein schönes Gesamtbild zu verwenden. Außerdem wird er mit der Zeit Erfahrungen sammeln, welchen Wortzwischenraum er einsetzt, weil manche Buchstaben einen solche Anstrich haben, daß vor ihnen ein weiter Raum sich bildet, der mit gewöhnlichem Wortzwischenraum ein Loch würde.
Der Setzer muß das alles während des Setzens bedenken, er muß das Druckbild vor Augen haben und wissen, daß er ein Schluß-r zwar gewöhnlich ans Wortende setzt, aber nicht vor ein Satzzeichen wie den Punkt oder das Komma, weil sonst ein unschönes Loch entstünde. Er muß auch wissen, daß es zwei z gibt: eines mit Unterlänge, eines ohne; und planvoll ist das jeweilige für ein schönes Gesamtbild zu verwenden. Außerdem wird er mit der Zeit Erfahrungen sammeln, welchen Wortzwischenraum er einsetzt, weil manche Buchstaben einen solche Anstrich haben, daß vor ihnen ein weiter Raum sich bildet, der mit gewöhnlichem Wortzwischenraum ein Loch würde.
Englische Schreibschrift imitiert Handschrift, den kalligraphischen Zug der Spitzfeder, die einen breiteren Strich zieht, wenn man sie durch Aufdrücken ein wenig spreizt. Wie so etwas original wirkt, ist in meinem Schaufenster unter Kalligraphie zu sehen.
 Die ersten Fotos zeigen einen vergrößerten und deshalb die Unregelmäßigkeit des Buchdrucks etwas gemein herausstellend einen Abzug “in der Stiftskirche”, darunter einmal im Bleisatz wie ihn der Schriftsetzer sieht, also kopfstehend gespiegelt, darunter für den Laien zur besseren Sicht gespiegelt auf den Fuß gestellt (eine Ansicht von der einem Schriftsetzer schwindelig wird, für meine Augen ist das richtig gemein). Zwischen “in” und “der” liegt ein 3 Didot-Punkte breites Spatium, zwischen “der” und “Stiftskirche” liegt nichts, weil das S so schwungvoll anhebt, daß es keinen Raum mehr braucht.
Die ersten Fotos zeigen einen vergrößerten und deshalb die Unregelmäßigkeit des Buchdrucks etwas gemein herausstellend einen Abzug “in der Stiftskirche”, darunter einmal im Bleisatz wie ihn der Schriftsetzer sieht, also kopfstehend gespiegelt, darunter für den Laien zur besseren Sicht gespiegelt auf den Fuß gestellt (eine Ansicht von der einem Schriftsetzer schwindelig wird, für meine Augen ist das richtig gemein). Zwischen “in” und “der” liegt ein 3 Didot-Punkte breites Spatium, zwischen “der” und “Stiftskirche” liegt nichts, weil das S so schwungvoll anhebt, daß es keinen Raum mehr braucht.
Die zweite Bildserie (Abzug, Bleisatz, Bleisatz gespiegelt) zeigt die beiden T in Tag und Trauung. Das eine erinnert an ein C, ich setze es nur dort ein, wo der Kontext die Bedeutung des Zeichens als T selbstverständlich wirken läßt.
Schöne Verschlingungen, was? Eine herrliche Arbeit, die einem solche Bilder vor Augen stellt. Welche Handwerkskunst steckt in diesen bleiernen Typen! Einige Verantwortung hat der Typograf, der Schriftsetzer, der Drucker, auf je seinem Gebiet vernünftig zu hantieren, also die Typen ihrem Duktus entsprechend zu verwenden, sie mit Vorsicht zu setzen, damit sie nicht brechen und schließlich sie mit Zartgefühl zu drucken und zu waschen.
Eine Nachfrage wird vorab beantwortet: Was sind das für Einschußlöcher in den flachen Teilen? Das sind Einstiche von der Ahle. Erstens prüft man so, ob die Zeile in der Form nicht wackelt, zweitens kann man so angepiekt die dicken Teile (Quadrate, Gevierte, Halbgevierte) gut herausheben. Ich mache das selten, aber wenn ich muß, dann handfest. Diese Stellen des Blindmaterials darf man so behandeln, es hat keine weiteren Auswirkungen.
— Martin Z. Schröder
Kommentare [2]


