Was warum schön ist. Teil 2 · 27. November 2008
Dies ist ein langsames Blog, und ich danke seinen Lesern für ihre Geduld. Die Druckerey läuft im Moment außerdem vorschriftsmäßig antizyklisch zur Krise und bildet damit ein leuchtturmhaftes Beispiel der Wirtschaft, was mich an raschem Fortkommen in der Sache Schönheit etwas hindert. Nun zu derselben.
Georg Kraus hat in seinem Kommentar zu Teil 1 die Romana-Schriften als Mode-Typen erwähnt, die sich nur schwer klassifizieren lassen. Sie haben Merkmale der Renaissance- wie der Klassizistischen Antiqua. Ein Leser, der nicht öffentlich kommentieren möchte, schreibt mir: “Allein bei den Bezeichnungen Romana, Romanisch, Römisch, Alt-Römisch, Lateinisch, Mediaeval, Old Style, Elzevir, Klassische Antiqua, French Old Style wird einem schwindelig.” Und er stellt mir freundlich einen Auszug aus seiner Romana-Akte zur Verfügung:
Die Versalien der Römischen Antiqua entwarf Albert Anklam für Genzsch & Heyse; 1885 geschnitten. Die Gemeinen stammen von Heinz König, 1888 gegossen. Ob das die Wurzeln der »Romana« sind und ob es den Zusatz in der Trennert-Probe »Der Originalschnitt dieses Schriftcharakters« klärt? Ich weiß es leider noch nicht. Stammbaumversuch: Schelter & Giesecke 1889 (oder doch erst 1896). De Vinne kauft 1885 bei Genzsch & Heyse die Versalien. Verhandlungen mit Central Type Foundry 1888/90, dort entstehen zwischen 1895 und 1898 mehrere Schnitte. Zahlreiche Nachschnitte z. B. Riegerl & Weißenborn, Matrizen gehen an ebenso zahlreiche Schriftenhäuser weltweit.
Das ist hübsches Material, weil es so schön verwirrend ist. Wir finden indes wohl keine dieser Schriften in den Sammlungen von Meisterschriften, weder war bei der berühmten Druckerei Poeschel in Leipzig so eine Type im Bestand noch läßt sich eine in Tschicholds Meisterbuch der Schrift entdecken, aber das heißt noch nicht, daß sie allesamt nicht viel taugten.
Aber das ist hier nicht das Thema. Es geht nur um eine einzige Schrift, von der wir bislang nicht einmal wissen, welche es ist. Irgendein Abkömmling aus einer der vielen Schriftgießereien. Also zurück zu dieser Type. Wir nehmen sie exemplarisch unter die Lupe, um auszuprobieren, wie man Schriften bewerten könnte.
Georg Kraus gibt in seinem Kommentar zu bedenken, daß Lesbarkeit keine objektivierbare Eigenschaft einer Schrift ist. Für Gutenberg war die Gotische sehr gut lesbar, uns würde sie erst einmal auf die Nerven gehen. Lesbarkeit hat etwas mit Gewohnheit zu tun. Wir können serifenlose Schriften leichter lesen als die Leute um 1910, weil wir ihnen täglich begegnen, sie lesen und sie tippen und Kinder heute in den Schulen mit Serifenlosen das Lesen beginnen. Ich schrieb schon in Teil 1, daß Lesbarkeit nur eng und nicht allgemein definierbar ist. Lesbarkeit bedeutet im Buch etwas anderes als auf dem Plakat oder einem Mobiltelefon. Und Lesbarkeit bedeutet für die Schönheit einer Schrift vielleicht gar nichts, wenn sie auch einem Dekor dient.
Zur Romana-Artigen aus dem Wiener Buchdrucklehrbuch: Wir können mit dem Schriftgut, daß uns vorliegt, einschätzen, daß ein schräger Querstrich im kleinen e auch 1910 ein Bruch mit der Konvention war, also ganz sicher nicht zur Lesbarkeit beitrug. Ein modischer Einfall, ein kleines historisches Zitat. (Übrigens gibt es auch in Schriften aus Meisterhand manchmal solche Zitate, das allein macht eine Schrift weder gut noch schlecht.)
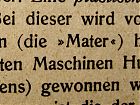 Heute schauen wir uns das M an. Auffällig ist, daß die beiden Mittellinien nicht auf die Schriftlinie hinuntergehen, sondern eine Art Schaukel bilden. Wenn der Name der Schrift ein Hinweis auf historische Vorbilder sein soll, ist diese Form des Buchstabens verfehlt. Die Capitalis Monumentalis als gemeißelte Type oder auch die Quadrata als die Buchschrift der
Heute schauen wir uns das M an. Auffällig ist, daß die beiden Mittellinien nicht auf die Schriftlinie hinuntergehen, sondern eine Art Schaukel bilden. Wenn der Name der Schrift ein Hinweis auf historische Vorbilder sein soll, ist diese Form des Buchstabens verfehlt. Die Capitalis Monumentalis als gemeißelte Type oder auch die Quadrata als die Buchschrift der 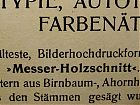 Römer oder die Rustica als deren Verkehrsschrift haben kein solches M. Interessant nebenbei ist der Blick auf die Überschriften und Auszeichnungen in dem Buch, die aus einer anderen Schrift desselben Stils gesetzt sind (das B mit seinen beiden ungleich gewichteten Hälften und dem mal geraden, mal schrägen Querstrich ist besonders auffällig, auch die Spitzen der A sind verschiedene) und auf die Halbfette, die ein eigenes M hat.
Römer oder die Rustica als deren Verkehrsschrift haben kein solches M. Interessant nebenbei ist der Blick auf die Überschriften und Auszeichnungen in dem Buch, die aus einer anderen Schrift desselben Stils gesetzt sind (das B mit seinen beiden ungleich gewichteten Hälften und dem mal geraden, mal schrägen Querstrich ist besonders auffällig, auch die Spitzen der A sind verschiedene) und auf die Halbfette, die ein eigenes M hat.
 Hier zwei Bilder aus einem Buch von 1926, dessen Schrift nicht gesetzt, sondern in Holz gestochen wurde. Ob diese künstlerische Freiheit durch das Ergebnis begründet wird, halte ich für fraglich. Ich finde das ganze Buch unschön, bei allem Respekt vor der Arbeit des Holzstechens. Die allerdings damals nicht so selten war wie heute. Der Holzstich war eine weit verbreitete
Hier zwei Bilder aus einem Buch von 1926, dessen Schrift nicht gesetzt, sondern in Holz gestochen wurde. Ob diese künstlerische Freiheit durch das Ergebnis begründet wird, halte ich für fraglich. Ich finde das ganze Buch unschön, bei allem Respekt vor der Arbeit des Holzstechens. Die allerdings damals nicht so selten war wie heute. Der Holzstich war eine weit verbreitete Reproduktionstechnik auch für einfache Firmenzeichen, Vignetten, sogar elektrische Schaltpläne. Jedenfalls das M: sowohl auf dem Titel als auch im Impressum hat es diese hochhängende Schaukel in der Mitte, so ist freilich auch möglich, den Buchstaben sehr schmal zu halten, aber ist es nötig? Paul Renner hat für seine Renner-Antiqua (1939) auch so ein kurzes M entworfen (nicht für deren Kursive), im schmalmageren Schnitt seiner Futura aber, deren normallaufende Schnitte in den Versalien die Proportionen der Monumentalis zitieren, reicht die M-Spitze bis auf die Schriftlinie. Das heißt, sie kann auch in schmalen Schriften erhalten werden. Zumal die Breite in der hier diskutierten Schrift gar nicht gemindert wurde, also die Verschmälerung des M war kein Anlaß für die Kürzung der beiden Innendiagonalen.
Reproduktionstechnik auch für einfache Firmenzeichen, Vignetten, sogar elektrische Schaltpläne. Jedenfalls das M: sowohl auf dem Titel als auch im Impressum hat es diese hochhängende Schaukel in der Mitte, so ist freilich auch möglich, den Buchstaben sehr schmal zu halten, aber ist es nötig? Paul Renner hat für seine Renner-Antiqua (1939) auch so ein kurzes M entworfen (nicht für deren Kursive), im schmalmageren Schnitt seiner Futura aber, deren normallaufende Schnitte in den Versalien die Proportionen der Monumentalis zitieren, reicht die M-Spitze bis auf die Schriftlinie. Das heißt, sie kann auch in schmalen Schriften erhalten werden. Zumal die Breite in der hier diskutierten Schrift gar nicht gemindert wurde, also die Verschmälerung des M war kein Anlaß für die Kürzung der beiden Innendiagonalen.
 In der Renaissance, deren Schriften auch irgendwie Pate für die Romana gestanden haben sollen, versuchten sich Künstler und Wissenschaftler an der Konstruktion von Buchstaben. Garamond (nicht einmal Bodoni) haben solches nie benötigt, weil man Schriften eben nicht konstruieren kann, sondern schreiben muß, und so sind diese Zeichnungen heute der Beweis für die Unmöglichkeit des Unterfangens. Ich zeige sie hier indes, um darzustellen, daß die Veränderung des M keine historische Grundlage hat und es nur eine Grundform gegeben hat, die von den berühmtesten Schriftkonstrukteuren nicht angezweifelt wurde. Ich habe jedenfalls keine andere gefunden. Wenn jemand Anlaß für Widerspruch hat, bitte ich um einen Hinweis.
In der Renaissance, deren Schriften auch irgendwie Pate für die Romana gestanden haben sollen, versuchten sich Künstler und Wissenschaftler an der Konstruktion von Buchstaben. Garamond (nicht einmal Bodoni) haben solches nie benötigt, weil man Schriften eben nicht konstruieren kann, sondern schreiben muß, und so sind diese Zeichnungen heute der Beweis für die Unmöglichkeit des Unterfangens. Ich zeige sie hier indes, um darzustellen, daß die Veränderung des M keine historische Grundlage hat und es nur eine Grundform gegeben hat, die von den berühmtesten Schriftkonstrukteuren nicht angezweifelt wurde. Ich habe jedenfalls keine andere gefunden. Wenn jemand Anlaß für Widerspruch hat, bitte ich um einen Hinweis.
 Damianus Moyllus hat um 1483 in Parma die älteste gedruckte Vorlagenfolge konstruierter Versalien gegeben. Jan Tschichold versah eine deutsche Übersetzung mit neuen Zeichnungen nach dem Original und veröffentlichte sie 1971 als Privatdruck von Bucherer, Kurrus & Co, Papiere en Gros; daraus stammen die beiden Fotos.
Damianus Moyllus hat um 1483 in Parma die älteste gedruckte Vorlagenfolge konstruierter Versalien gegeben. Jan Tschichold versah eine deutsche Übersetzung mit neuen Zeichnungen nach dem Original und veröffentlichte sie 1971 als Privatdruck von Bucherer, Kurrus & Co, Papiere en Gros; daraus stammen die beiden Fotos.
 Wer diese Konstruktion mit Zirkel, Dreieck und Lineal (oder im Computer) um ein M legt, wird rasch finden, wie hilfreich sie für einen Anfänger ist, wie nutzlos sie für einen Schriftkünstler sein muß. (Etwa in der Garamond wird der Scheitel des M deutlich tiefer, über die Schriftlinie hinaus gezogen, damit er optisch eben auf derselben steht. Die Futura, die als “konstruierte” Schrift gilt, zeigt im deutlich über die Oberlänge hinausgehenden spitzen A, wie wenig sie im Detail am Konstrukt hängt.)
Wer diese Konstruktion mit Zirkel, Dreieck und Lineal (oder im Computer) um ein M legt, wird rasch finden, wie hilfreich sie für einen Anfänger ist, wie nutzlos sie für einen Schriftkünstler sein muß. (Etwa in der Garamond wird der Scheitel des M deutlich tiefer, über die Schriftlinie hinaus gezogen, damit er optisch eben auf derselben steht. Die Futura, die als “konstruierte” Schrift gilt, zeigt im deutlich über die Oberlänge hinausgehenden spitzen A, wie wenig sie im Detail am Konstrukt hängt.)
Das M der ersten Fotos dieses Eintrages aus dem Buchdrucklehrbuch ist modisch gemacht. Seine Abweichung von den guten Schriften ist kaum anders zu begründen. Es wirkt unbeholfen und “besonders”. Kann man nun schon sagen, daß es objektiv kein schöner Buchstabe ist? Oder gibt es eine gut lesbare Buchschrift, die beweist, daß sich ein innen verkürztes M problemlos in einen Text einfügen kann?
— Martin Z. Schröder
Kommentare [4]

